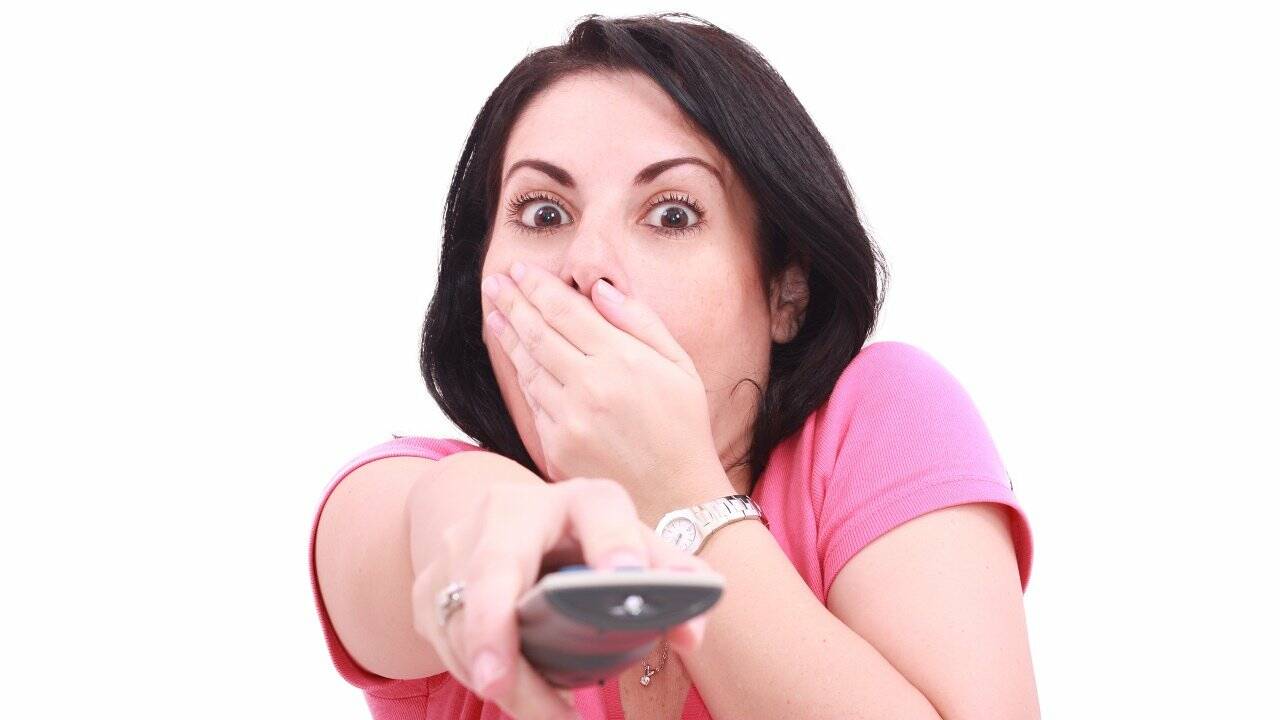Endlich herrscht Ruhe beim Fernsehen, denn der Elektronikkonzern Samsung riet unlängst dazu, bei privaten Gesprächen im eigenen Wohnzimmer vorsichtig zu sein, wenn man eines seiner Smart-TV-Geräte besitzt. Ist die Bedienung des Fernsehers per Sprache eingeschaltet, um auf Zuruf zum Beispiel lauter oder leiser zu drehen, hört das Gerät bei allem mit, was im Raum gesprochen wird. Unter Umständen schickt der Fernseher den Mitschnitt des Gesprächs sogar über das Internet zu einem Unternehmen, um bei komplexeren Sprachbefehlen die Analyse für Samsung zu bewerkstelligen. Besitzer eines Smart-TV sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie "Persönliches oder Sensibles" in der Nähe des Fernsehers aussprechen. Also: Ruhe, wenn der Fernseher läuft!
Einige Internetnutzer sahen sich mit den Überwachungsmethoden aus Orwells Roman "1984" konfrontiert. Auch wenn die Aufregung, die da hyperventiliert wurde, nur teilweise gerechtfertigt ist, macht sie doch auf jene Umstände aufmerksam, die derzeit den Ruf vieler digitaler Innovationen beschädigen:
Erstens gibt es unabsehbare Möglichkeiten, jede Nebensächlichkeit, die ein Nutzer von sich gibt, zu analysieren. Jede noch so unbedeutende Handlung, jedes Nebengeräusch kann so zum wertvollen Informationsbaustein werden. Allein durch das Auswählen eines Fernsehprogramms und das Googeln im Internet geben wir viel mehr preis, als uns lieb ist. Wer einen Werbespot sieht und dann eine Suchanfrage zum beworbenen Produkt startet, ist ein möglicher Kunde. Wer den Fernsehdoktor einschaltet und sich im Internet über die besprochene Krankheit informiert, ist wahrscheinlich betroffen. In der Kombination ergeben diese Handlungen sehr sensible Informationen, die höchst schutzwürdig sind.
Zweitens ist da die oft leichtfertige Datenweitergabe an Dritte. Im Fall des Big-Brother-Fernsehers schrieb der Hersteller in einer Stellungnahme gar: "Samsung ist nicht verantwortlich dafür, wie diese Drittanbieter Privatsphäre- und Sicherheits-Maßnahmen umsetzen."
Das kann doch nicht wahr sein! Diese Verantwortung muss jedes Unternehmen wahrnehmen, dem man bewusst oder unbewusst Daten anvertraut. Firmen, die Aufträge an Dritte weitervergeben, sind für die ordnungsgemäße Durchführung noch immer verantwortlich. Das muss auch in der digitalen Welt gelten.
Diese Verantwortung geht drittens aber noch weiter, denn dieser Industriezweig entwickelt sich enorm schnell. Immer wieder treten Start-ups mit neuen Ideen an, was man aus Daten noch machen kann. Sind sie erfolgreich, werden sie von den Datensammlern wie Google und Facebook gekauft. Die gesammelten Daten und Erkenntnisse inklusive. Bestes Beispiel dafür ist WhatsApp. Inzwischen 700 Millionen Nutzer verlagerten ihre Social-Media-Aktivitäten auf diesen Dienst, weil ihnen die Kommunikation auf Facebook zu öffentlich war. Vor einem Jahr gelang es Facebook aber, WhatsApp zu kaufen. Seither müssen sich die Nutzer die Frage stellen: Wie lang gilt das Versprechen von WhatsApp-Gründer Jan Koum und Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dass die Kundendaten von WhatsApp und Facebook unter dem gemeinsamen Konzerndach nicht zusammengeführt werden? WhatsApp behielt zwar demonstrativ seinen Firmensitz außerhalb des Facebook-Geländes. Das Versprechen der getrennten Daten schaffte es aber nicht schwarz auf weiß in die gerade eben aktualisierten Datenschutzregeln von Facebook. Dort heißt es sogar, dass Daten zwischen verschiedenen Angeboten aus dem Hause Facebook ausgetauscht werden können. WhatsApp betont zwar weiterhin, möglichst wenig Daten über seine Nutzer zu sammeln, während Facebook davon lebt, Werbepartnern gezielten Zugang zu gewünschten Nutzergruppen zu gewähren. Beide Dienste zusammen ergäben aber ein perfektes Persönlichkeitsprofil, dessen Nutzung man sich auf lange Sicht sicher nicht entgehen lassen will, und sei es nur, um WhatsApp auch weiter finanzieren zu können.
Es ist noch ein weiter Weg, bis wir für unser digitales Leben ein Regelwerk gefunden haben, das dem unseres analogen Lebens entspricht. Vor allem fehlt noch immer der Wille, Nebengeräusche, die diese Technologien produzieren, zu unterbinden, indem man die ausbeuterische Nutzung der gewonnenen Daten untersagt. Auch mit der Konsequenz, dass wir für viele Anwendungen im Netz wieder etwas bezahlen müssten. Denn die Nebengeräusche können das Vergnügen, die neuen Technologien zu nutzen, ordentlich vermiesen. Sie machen Angst und geben uns das Gefühl, uns ständig selbst das Wort verbieten zu müssen. Das darf nicht sein. Vielleicht mit einer Ausnahme. Wenn der Fernseher läuft, gilt weiter: Ruhe!