Stenografie
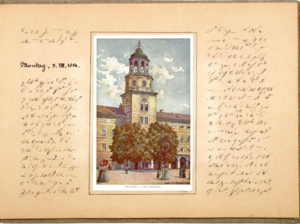
Stenografie, auch: Kurzschrift, ist eine Schrift, die aus einfachen Zeichen gebildet ist, damit sie wesentlich schneller als die Standardschrift der jeweiligen geschrieben werden kann, idealerweise um Gehörtes in derselben Geschwindigkeit, wie man es hört, aufschreiben zu können.[1]
Kurzer geschichtlicher Exkurs
Bereits im ersten Jahrhundert vor Christus wurde die Stenografie von einem freigelassenen Sklaven erfunden. Aber erst in der Neuzeit entwickelte sie sich in Großbritannien zur dann bekannt gewordenen Kurzschrift. Das erste deutschsprachige Stenografielehrbuch wurde 1678 veröffentlicht. Heute ist die Deutsche Einheitskurzschrift 1968 ("Wiener Urkunde") das Standardsystem in Deutschland und Österreich.
Bis fast Ende des 20. Jahrhunderts waren die Kenntnisse in Stenografie eine der Voraussetzungen für Sekretärinnen. Ihnen wurden Briefe diktiert, die sie stenografisch mitschrieben und anschließend rein in Maschinschrift zu Papier brachten. Erst nach und nach kamen Diktiergeräte in Umlauf und das Mitstenografieren erübrigte sich. Aber noch heute wird im Parlament und bei Gerichtsverhandlungen stenografiert.
Allgemeines über die Deutsche Einheitskurzschrift
Die in Deutschland und Österreich standardmäßig verwendete Kurzschrift ist die Deutsche Einheitskurzschrift. Sie hat drei Stufen, die sich im Grad der Verkürzung und daher in der erreichbaren Schreibgeschwindigkeit unterscheiden:[2]
- Die Grundstufe der Kurzschrift heißt Verkehrsschrift. Damit erreicht man durchschnittlich eine Schreibgeschwindigkeit von 120 Silben in der Minute.
- Die Praxis erforderte aber bald eine höhere Geschwindigkeit, und es entstand die Eilschrift.
- Bei der Eilschrift unterscheidet man zwei Hauptgruppen: 1. Die Stammkürzung und 2. die Formkürzung. Damit erreicht man eine Schreibgeschwindigkeit bis zu etwa 200 Silben pro Minute.
- Bei der Redeschrift wird die Reduzierung der geschriebenen Zeichen noch gesteigert, indem etwa für feststehende Redewendungen zusätzliche Kürzel bestehen. Mit der Redeschrift erreichen manche Stenografen kurzzeitig Schreibgeschwindigkeiten von 500 Silben pro Minute und mehr.[2]
Die Stenografie in der Geschichte Salzburgs
Blickt man in historische Schriftverkehrsstücke, kann man immer wieder Briefe stenografiert finden. Daneben war bis Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich auch die Kurrentschrift Standard.
Die "Salzburger Zeitung" berichtete in ihrer Ausgabe vom 25. August 1798[3] ausführlich – "Stenographie ist die Lehre von der Kunst, mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit und Kürze in einfachen von andern Schriftzügen völlig verschiedenen Zeichen zu schreiben." Im weiteren Text wird die Stenografie auch "Geschwindschreiben" genannt. In ihrer Ausgabe vom 6. März 1819 weiß die "Salzburger Zeitung" zu berichten: "Zu der Tachygraphie und Stenographie ist nun auch eine Notographie gekommen. Schnellschreiben ist ihr Zweck; ihre Zeichen sind aber noch einfacher, ...".[4] Überhaupt beschäftigten sich Medien, die im Land Salzburg erschienen, oft mit der Stenografie, was rund 12 700 Eintragungen in den digitalisierten Zeitungen und Zeitschriften der Österreichischen Nationalbibliothek (ANNO) unter der Selektion "Erscheinungsort Salzburg" zeigen.
In einem Brief vom August 1858 von Franz II. Xaver Gregor Spängler an seine Frau Antonia beklagt dieser sich, dass der Bruder für die stenografische Zeitschrift in Wien nichts geschrieben hatte.
Das Urlaubstagebuch der Maria Kitzler aus dem Jahr 1914 ist komplett in Kurzschrift geschrieben.
"Tüchtige weibliche Bürokraft, perfekt in Stenographie und Maschinschreiben, und jüngere männliche Bürokraft zum sofortigen Eintritt gesucht. Franz Welz, internationale Transporte." - Ein für die 1950er- und 1960er-Jahre typisches Inserat in den "Salzburger Nachrichten".[5]
In der Höheren Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe Schloss Kleßheim wurde noch in den 1970er-Jahren Stenografie unterrichtet. Der SALZBURGWIKI-Mitarbeiter Peter Krackowizer erinnert sich in seiner Autobiografie "Reiseleiter gehen durchs Fegefeuer" an eine Anekdote im Zusammenhang mit dem Unterrichtsfach Stenografie:
Meine Stenografie-Nachprüfung im Herbst 1973. Zurückkommend auf meine bereits erwähnte Stenografie-Nachprüfung möchte ich erklären, wie es dazu gekommen war. [...] Nun kam ich nach Kleßheim und hatte Fachlehrerin Helga Hanke in diesem Fach. Ich erzählte ihr, dass ich bereits stenografieren konnte. Woraufhin sie mir erklärte, ich dürfe aber immer nur so viel bei Schularbeiten und Tests anwenden, wie sie es bis dahin auch schon unterrichtet hätte. Sollte ich etwas stenografieren, was sie noch nicht unterrichtet hat, würde sie es mir als Fehler anrechnen. Das war für mich aber gar nicht mehr möglich. Ich stenografierte, wie ich es bereits konnte, und so bekam ich bei Tests einen Fünfer nach dem anderen. Nicht, weil ich Fehler gemacht hätte, sondern weil ich eben etwas unerlaubt schon abgekürzt hatte. Irgendwann im dritten Trimester (in der ersten und zweiten Klasse hatten wir noch Trimester) weigerte ich mich bei Arbeiten mitzuschreiben. Die Folge war ein Fünfer im Jahreszeugnis und eine Nachprüfung. Doch wie es im Leben so ist, bei der Nachprüfung sprach die Verordnung, es müsse nur richtig sein – egal mit welchem Wissensstand. Nun ja, ich bestand die Nachprüfung glänzend und im zweiten Schuljahr wurde ich im Fach Stenografie – die Eilschrift wurde Gegenstand des Unterrichts – zum Liebling von Frau Hanke.
Quellen
- "Wir stenografieren. Eilschrift." 1970, Jugend und Volk Verlagsges.m.b.H. Wien
- "Winklers Wörterbuch der Deutschen Einheitskurzschrift", Winklers Verlag, Gebrüder Grimm, Darmstadt, 1973
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von Peter Krackowizer, der noch Stenografieren lernte, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind