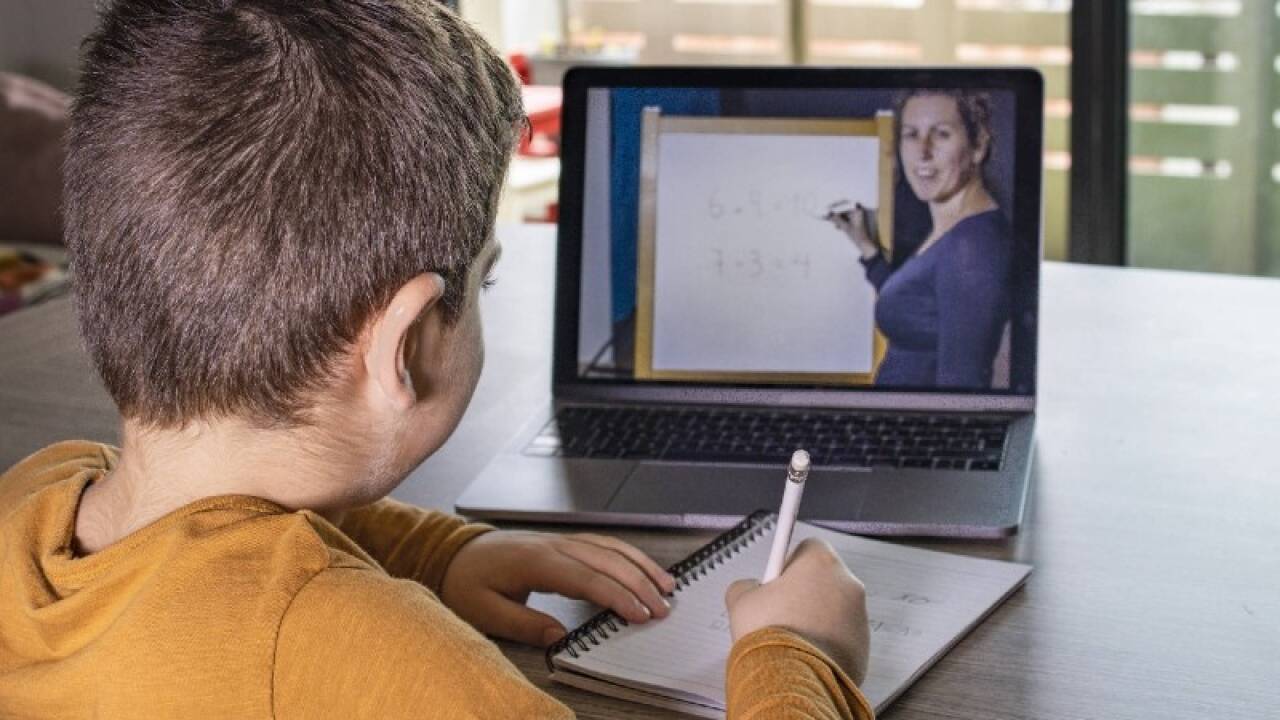Herr Professor, die Schulen sind seit Monaten im Distanz-unterricht. Ihr Fazit? Henrik Saalbach: Ob Fernunterricht gelingt oder nicht, hängt vom Engagement der Lehrperson bzw. der Schule ab. Bei manchen klappt es sehr gut, bei manchen weniger. Im Gegensatz zum ersten Lockdown waren die Schulschließungen im Herbst absehbar. Leider scheint es die Politik versäumt zu haben, im Sommer entsprechende Vorkehrungen zu treffen - sprich: bessere Ausstattung der Schulen, bessere Lernkonzepte für die Schüler.
Birgt diese Ausnahmesituation auch Chancen? Durch die Krise wurden die Schwächen des Bildungssystems aufgezeigt, z. B. dass es zu bürokratisch und unflexibel ist. Hier gilt es nun anzusetzen und Reformen auf den Weg zu bringen. Auch die Bedeutsamkeit der pädagogischen Arbeit hat an Anerkennung gewonnen, das sehe ich als Chance für die Zukunft.
Kann Bildungsvermittlung auf digitalem Weg über längere Zeit funktionieren? Ja, unter gewissen Voraussetzungen schon. Aber eines ist klar: Fernunterricht kann nie so gut wie Präsenzunterricht sein.
Warum? Zunächst fehlt das Soziale, das Zwischenmenschliche. Der Austausch mit der Lehrperson und mit den Mitschülern ist zentral. Vor allem sozial benachteiligte Kinder haben im Heimunterricht klare Nachteile. Was auch fehlt, ist das Unmittelbare, d. h. die Schüler bekommen - wenn überhaupt - erst mit Zeitverzögerung Rückmeldung auf das Gelernte. Es geht darum, Lernprozesse zu aktivieren. Die Lehrer müssen Unterricht, Übungen und Aufgaben ständig an den Lernstand der Kinder anpassen. Das ist im Präsenzunterricht viel einfacher.
Wie sollte Distanzunterricht denn nun gestaltet sein, damit Kinder profitieren? Spielt das Alter eine Rolle? Grundsätzlich unterscheiden sich die Lernprozesse nicht zwischen jüngeren und älteren Schülern, denn sie funktionieren nach den gleichen Prinzipien. Die Anforderungen an guten Fernunterricht sind daher für alle Jahrgangsstufen ähnlich. Was sich je nach Alter selbstverständlich unterscheidet, sind die Mittel und Inhalte, diese Lernprozesse anzustoßen. Der Volksschüler springt auf spielerisches Rechnen an, der Oberstufenschüler auf Knobelaufgaben. Idealerweise haben die Aufgaben einen Bezug zur eigenen Lebenswelt, damit Interesse geweckt wird.
Generell ist wichtig, dass es sich um kognitiv aktivierende Lerninhalte handelt. Das bedeutet, die Aufgaben müssen gut strukturiert sein, viele Beispiele enthalten und an zuvor Gelerntes anknüpfen. Nächstes Stichwort: Abwechslung! Anstatt ein Arbeitsblatt nach dem anderen abzuspulen, sollte es zwischendurch Spiele, Denkaufgaben, ein Quiz oder Ähnliches geben. Eines der effektivsten Mittel beim Lernprozess ist und bleibt das Feedback. Die Rückmeldung zum Lernstand des Kindes ist immens wichtig! Im besten Fall geschieht dies per Video und in kurzen Abständen, damit sich Fehler nicht manifestieren. Regelmäßiges Feedback führt zum Erleben von Kompetenz, was wiederum sehr motivierend ist!

Was brauchen die Jüngsten, um mit dieser Art des Lernens umzugehen? Zum Homeschooling gehört nicht nur die inhaltliche Dimension, also der Stoff an sich, sondern auch Faktoren wie Motivation, Selbstorganisation und -regulation. Hier tun sich Volksschüler natürlich schwerer als Ältere, die diese Fähigkeiten bereits mehr entwickelt haben. Je jünger die Kinder sind, umso mehr klare Regeln und Strukturen brauchen sie - und die Hilfe ihrer Eltern. Ein gut organisierter Fernunterricht kann hier sehr wirksam sein.
Was ist für Lehrende die größte Herausforderung? Der Kontakt darf nicht verloren gehen. Deshalb rate ich zu regelmäßigen Videokonferenzen in allen Jahrgangsstufen - Volksschüler können das, wenn man sie richtig heranführt. Das schafft Struktur und gibt den Schülern Sicherheit. Auch Gruppenarbeit ist online möglich, um gemeinsam zu diskutieren oder sich in Teams auszutauschen. Hier gibt es viele tolle Onlinetools, da sind die Lehrer gefragt, sich mit diesen auseinanderzusetzen und sie sinnvoll im Unterricht einzubauen. Kooperative Lernformen wirken übrigens motivierend und sind häufig lernwirksamer.
Wie sollte die Zeit nach der Schulöffnung aussehen? Man kann nicht sofort "back to normal" gehen, als wäre nichts gewesen! Man muss schrittweise anfangen und das kompensieren, was versäumt wurde. Dies wird sicher nicht in ein paar Wochen zu schaffen sein. Dabei müssen die Prioritäten bei den Hauptfächern und der Förderung lernschwacher Schüler liegen.
Zur Person:
Prof. Dr. Henrik Saalbach ist Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Leipzig (D).