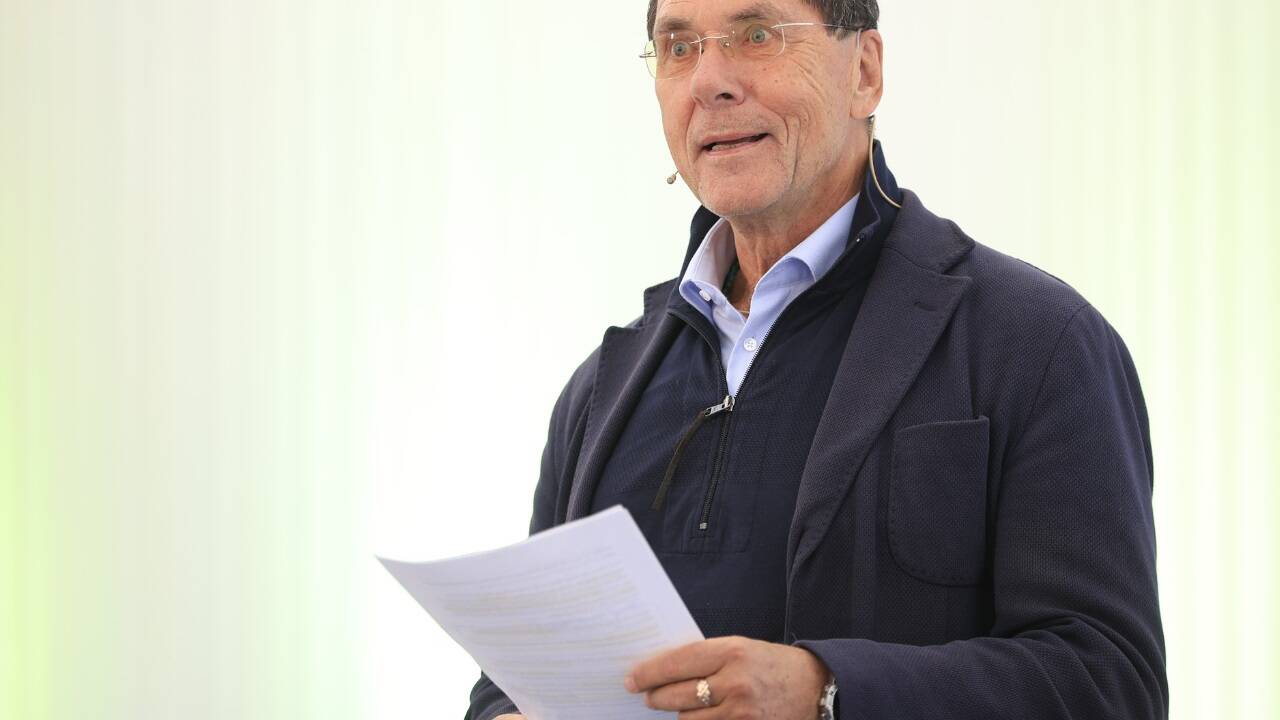Mit jährlich bis zu 31 Millionen Besuchern bei einer Einwohnerzahl von aktuell knapp über neun Millionen kommen auf jede Österreicherin bzw. jeden Österreicher im Schnitt 3,4 Touristen - und das Jahr für Jahr. Die negativen Auswirkungen von "Overtourism" zu vermeiden und den An- und Abreiseverkehr mittels nachhaltiger Mobilitätskonzepte vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern ist eine der größten Herausforderungen für die Tourismusbranche.
Alpine Ski-Weltmeisterschaften sind nach den Olympischen Winterspielen die größten Wintersportevents der Welt. Von 4. bis 26. Februar 2025 werden die Titelkämpfe zum zweiten Mal nach 1991 in Saalbach-Hinterglemm stattfinden. Wie die Pinzgauer Tourismusregion mit dem zu erwartenden Besucheransturm umgehen wird, darüber berichtete der Projektleiter der Ski-Weltmeisterschaft, Florian Phleps vom Österreichischen Skiverband (ÖSV), im Zuge seiner Keynote. "Im Gegensatz zu früheren Weltmeisterschaften finden sämtliche Rennen der WM auf ein und demselben Berg und mit einem einzigen Zielgelände statt", so der zuständige Projektleiter, der zudem betont, dass der Publikums-Skibetrieb in der Region Saalbach-Hinterglemm während der WM uneingeschränkt weiterlaufen wird. "Dabei werden nicht nur die Parkplätze der Bergbahnen weiterhin verfügbar bleiben, auf Ski ist es zudem möglich, die Rennen kostenlos vom Streckenrand mitzuverfolgen."
Da Saalbach im Gegensatz zu früheren heimischen WM-Austragungsorten wie etwa Schladming oder St. Anton über keinen eigenen Bahnanschluss verfügt, wurde im Vorfeld des Events der Bahnanschluss in Maishofen ausgebaut und modernisiert. "Damit können ab sofort endlich auch Fernverkehrszüge mit modernen Doppelzugsgarnituren in Maishofen stehen bleiben", so Florian Phleps. Um die individuelle Mobilität der Bewohner und Urlaubsgäste des Glemmtals zu gewährleisten, werden die WM-Zuschauer die restlichen rund 14 Kilometer bis zum Zwölferkogel mit Shuttlebussen zurücklegen.
Beim Vorverkauf der WM-Tickets legte man seitens der Organisationsteams den Schwerpunkt auf Mehrtagestickets - so soll die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Tagesgäste minimiert werden. "Wir gehen davon aus, dass 50 bis 60 Prozent der Ticketkäufer im Glemmtal übernachten werden - das bringt eine enorme Entlastung des Verkehrs und zusätzliche Wertschöpfung in der Region", so Phleps.
Mit Ausnahme des neuen Busterminals in Hinterglemm-Ost, der nach der WM dem Nahverkehr im Tal zugutekommen wird, konnte auf die Versiegelung von Grünflächen verzichtet werden. Der aus Sicherheitsgründen erforderliche Notweg in bzw. aus dem Glemmtal wird nach der Veranstaltung als Rad- bzw. Fußweg weiterverwendet und wertet so die autofreie Infrastruktur auf.
Neben ÖSV-Projektleiter Florian Phleps konnte auch der Geschäftsführer der IGM Salzburgring, Ernst Penninger, einiges zum Thema Mobilitätsplanung von Großveranstaltungen beitragen - schließlich geht am Salzburgring seit vielen Jahren das mit Abstand größte Musikfestival mit insgesamt rund 45.000 Besuchern über die Bühne. "Um eine derartige Großveranstaltung durchführen zu können, braucht man natürlich sehr viel Verständnis aus der unmittelbaren Nachbarschaft", berichtet Ernst Penninger. "Dazu haben wir seit vielen Jahren eine hervorragende Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden."
Wenngleich bis zu 18.000 Besucher während des Festivals auf dem nahe gelegenen Campingplatz übernachten, ist man beim Salzburgring stolz darauf, dass etwa die Hälfte der Anreisenden auf das eigene Auto verzichtet. "Wir haben dafür eine ganze Reihe von Hubs in der Region definiert, von wo eigens eingerichtete Buslinien von der Stadt Salzburg, dem Flachgau und dem Salzkammergut aus zum Festivalgelände fahren", berichtet Penninger. Ein ähnliches Prinzip kommt während der Auf- und Abbauarbeiten zur Anwendung, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. "Jeder einzelne Lkw wird außerhalb des Ringgeländes abgefangen und erhält in der Folge einen individuellen Slot - so können wir ein Verkehrschaos auf den schmalen Zufahrtsstraßen vermeiden." Zum Abschluss der Veranstaltung berichteten Günther Grall von der FH Salzburg und Klaus Bengler von der TU München von ihren Erfahrungen im Zuge des Projekts UNICARagil, bei dem autonom fahrende Shuttlebusse entwickelt und getestet wurden.
Weitere Infos unter: www.sn.at/mobilitaet
Die Veranstaltung wird von der Europäischen Union im Programm INTERREG VI-A Programm Deutschland/Bayern-Österreich 2021-2027 gefördert. Projektpartner: Salzburger Nachrichten, SalzburgerLand Tourismus GmbH, TSG Tourismus Salzburg GmbH, Bad Reichenhall Tourismus & Stadtmarketing GmbH, Bergerlebnis Berchtesgaden, Chiemgau GmbH Tourismus.