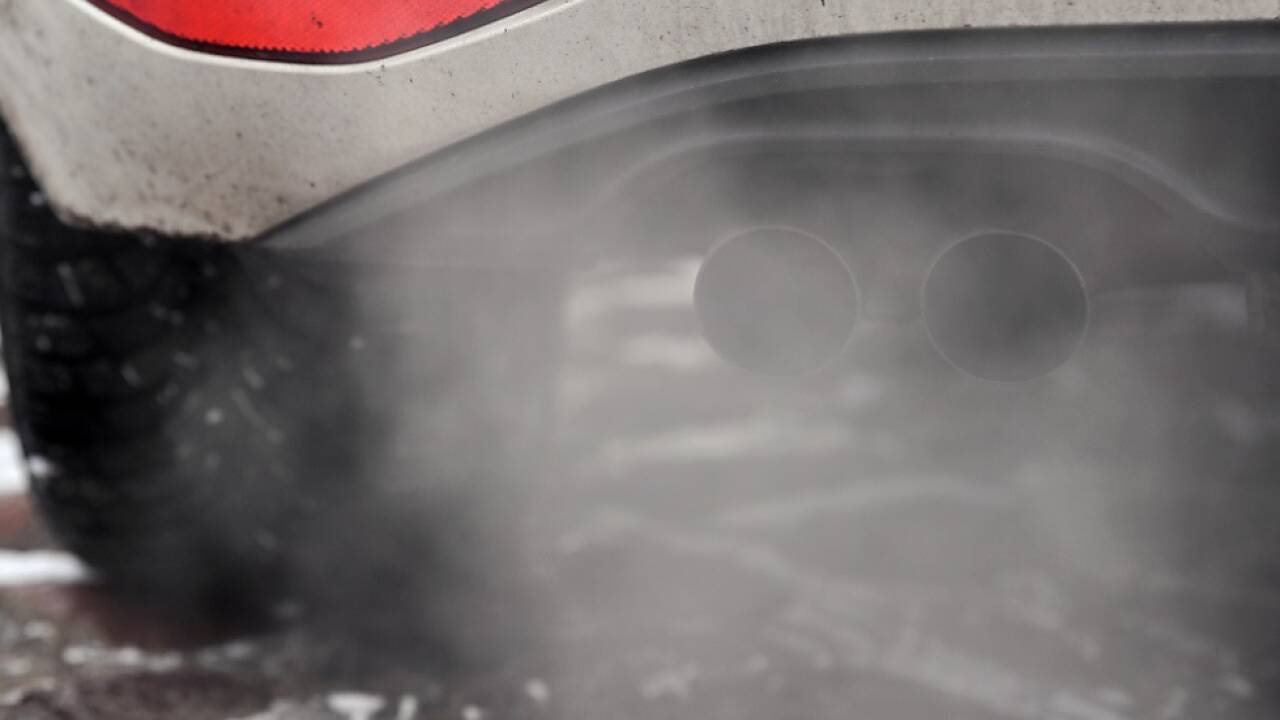Emissionen von Treibhausgasen in Österreich sollen in Zukunft mithilfe von Satelliten in Kombination mit aufwendigen Modellberechnungen bestimmt werden. Ein österreichisches Konsortium entwickelt derzeit im Projekt "GHG-KIT" Methoden dazu. In dieser Woche treffen die an dem Projekt beteiligten Organisationen in Innsbruck zusammen, wie die Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.
Der Hintergrund ist das Pariser Klimaschutzabkommen, das Europas Staaten verpflichtet, bis 2030 die Emission der Treibhausgase um zumindest 55 Prozent zu reduzieren. Um die Fortschritte zu überwachen, übermitteln alle Staaten jährlich Daten ihrer Treibhausgas-Emissionen. In Österreich ist dafür das Umweltbundesamt zuständig.
Derzeit spielen Satellitendaten beim Treibhausgasmonitoring nur wenig Rolle
Derzeitige und geplante Messgeräte in Satelliten ermöglichen künftig noch genauer, die Quellen und Senken von Treibhausgasen zu analysieren, und basierend darauf mit Modellanwendungen zu berechnen, wo und in welcher Menge Treibhausgase entstehen beziehungsweise abgebaut werden. Allerdings spielte die Nutzung von Satellitendaten bei Fragen des Luftqualitäts- und Treibhausgasmonitorings in Österreich bisher noch eine untergeordnete Rolle.
Ein Problem war bisher vor allem die Kenntnis der räumlich und zeitlich variierenden Emissionen, erläuterte Geosphere Austria. Mittels neuer Messgeräte, wie an den Sentinel-Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, können Satellitendaten für einige Luftschadstoffe und Treibhausgase verstärkt genutzt werden, um aktuelle Veränderungen von Schadstoff- und Treibhausgaskonzentrationen (Schwankungen von Jahr zu Jahr sowie saisonale bis nahezu tägliche Variabilität) flächendeckend mit hoher Genauigkeit zu untersuchen.
Österreichisches Konsortium hat einen Prototypen entwickelt
Im Projekt "GHG-KIT: Keep it traceable" entwickelt ein österreichisches Konsortium nun einen Prototypen für ein satellitengestütztes, unabhängiges System für die Verifizierung von Treibhausgasen in Österreich, um künftig das Umweltbundesamt beim Berichten der jährlichen Treibhausgasemissionen an die europäische Kommission zu unterstützen. Das Konsortium besteht aus den Firmen GeoVille (Projektleitung), SISTEMA, Cloudflight und Earth Observation Data Center (EODC) sowie aus den wissenschaftlichen Organisationen GeoSphere Austria, Universität Wien und Technische Universität Wien.
Die GeoSphere Austria ist im Projekt zuständig für die Ermittlung des Endnutzerbedarfs (in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt) sowie für die Planung des Konzepts. "Das reicht von der Kombination der Messdaten von Satelliten und Bodenstationen über die Berechnungsmethoden bis zur Evaluierung des Gesamtsystem", schilderte Marcus Hirtl, an der GeoSphere Austria Leiter der Chemischen Wettervorhersage. "Außerdem verantworten wir im Projekt die numerische Ausbreitungsmodellierung, also die Berechnungen, welche Mengen Treibhausgase durch natürliche und menschliche Quellen in die Atmosphäre kommen, wie sie sich in der Atmosphäre ausbreiten und in welchem Ausmaß sie wieder verschwinden, zum Beispiel bei der Aufnahme von Kohlendioxid durch Pflanzen."
Wissenschaftlicher Kongress in Innsbruck soll Projekt voranbringen
Am 12. und 13. April treffen einander in Innsbruck rund 50 Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Organisationen sowie Expertinnen und Experten aus Norwegen, Irland, Italien und Kanada. In mehreren Meetings werden die aktuellen Ergebnisse besprochen und die nächsten Schritte geplant. Das Projekt "GHG-KIT" läuft von September 2022 bis April 2025 und wird finanziert von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) sowie vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.