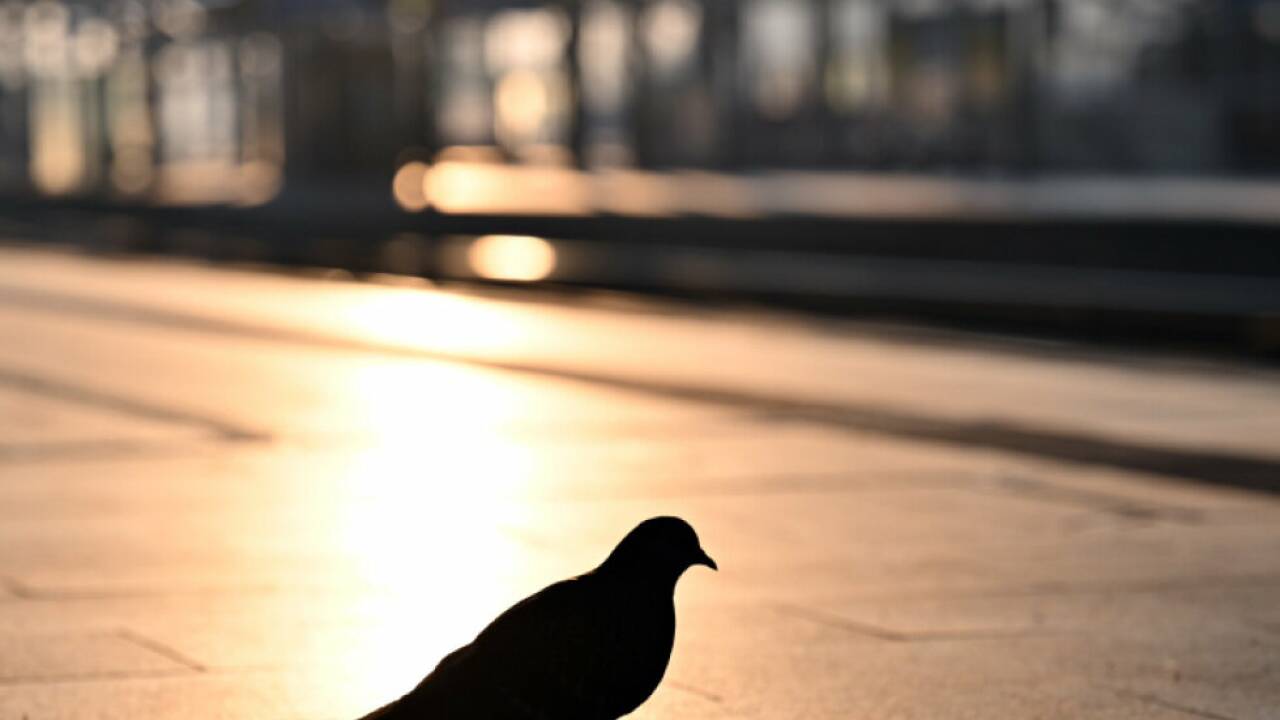Über seine Entdeckung berichtet das Team um die Doktoranden Grégory Nordmann und Spencer Balay im Fachmagazin "Science". Bei ihrem neuen Ansatz auf der Suche nach dem mysteriösen Magnetsinn, auf dessen Existenz haufenweise Beobachtungen von vor allem weitwandernden Tieren - allen voran Vögeln - hindeuten, orientieren sich die Forschenden an einer mehr als 100 Jahre alten Idee des französischen Naturforschers Camille Viguier, heißt es in einer Aussendung der Uni München.
Viele Ideen zu komplexem Problem
Er war einer der ersten, der sich eingehender mit der Thematik auseinandergesetzt hat, und vertrat bereits 1882 die Idee, dass elektrische Ströme im Innenohr der Tiere erzeugt werden, die für die Wahrnehmung von Magnetfeldern genutzt werden könnten. Dieser Ansatz stand lange neben anderen Theorien: So gab es Annahmen, dass die Basis des Magnetsinnes etwa in Eisenkristallen liegt, die an Zellen gebunden sind, die wiederum deren durch Magnetveränderungen ausgelöste Bewegungen detektieren. Manche vermuteten, dass die Fähigkeit mit der Bewegung von Flüssigkeiten im Innenohr in Zusammenhang steht. Zudem gibt es auch das Konzept des Radikalpaarmechanismus oder einer Art "Quantenkompass". Die Idee eines derartigen Magnetdetektors, der auf Licht beruht, fußte auf Beobachtungen, wonach manchen Zugvögeln ihr präziser Orientierungssinn in der Dunkelheit bzw. beim Fehlen bestimmter Lichtanteile abhandenkommt.
Zum Beispiel im Jahr 2020 gingen Keays und Kollegen noch in Wien im Fachblatt "Science Advances" letzterer Idee nach - mit damals vielversprechenden Ergebnissen. Nun wandte man sich in München der alten, eher in Vergessenheit geratenen Theorie zu, nachdem die Neurowissenschafter ergebnisoffen Gehirne von Tauben untersuchten, die Magnetfeldern ausgesetzt waren.
Möglicherweise mehrere Magnetsinne in der Natur
Mit modernen Mikroskopie-Methoden kamen die Forschenden nun tatsächlich auf die Spur von Nervenzell-Schaltkreisen, die mit dem Magnetsinn in Verbindung stehen dürften und fanden auch "einen entscheidenden Hinweis auf die Lage der primären Magnetsensoren", heißt es. In Reaktion auf das Magnetfeld zeigte sich eine starke Aktivierung in einer bestimmten Hirnregion - dem Vestibularkern. Hier handle es sich um eine Struktur, in der ein magnetisches in ein elektrisches Signal umgewandelt werden könnte. Der Vestibularkern ist über Nervenbahnen auch mit dem Innenohr verbunden. Als das Team dort genauer nachforschte, fand es genetische Hinweise auf Zellen, die als hochempfindliche elektrische Sensoren fungieren. Derartige Spezialzellen verwenden auch Haie, um in Finsternis ihre Beute zu orten.
"Die von uns beschriebenen Zellen sind ideal dafür geeignet, Magnetfelder mithilfe elektromagnetischer Induktion zu erkennen - so finden Tauben ihren Weg nach Hause nach dem gleichen physikalischen Prinzip, das auch das kabellose Laden von Mobiltelefonen ermöglicht", werden die Wissenschafter zitiert. Endgültig nachgewiesen ist die biologische Grundlage für den Magnetsinn aber trotzdem nicht, wie auch Keays einräumt: "Unsere Daten deuten darauf hin, dass es im Innenohr einen sogenannten 'dunklen Kompass' gibt, während andere Studien auf einen lichtabhängigen Kompass im visuellen System hinweisen." Damit wäre man wieder beim Radikalpaarmechanismus gelandet. Die salomonische Lösung könnte sein, dass sich die Fähigkeit, Magnetismus wahrzunehmen, im Laufe der Entwicklungsgeschichte in unterschiedlichen Organismen mehrmals auf unterschiedlichen Wegen entwickelt hat. Demnach gebe es also "noch viel zu entdecken", so der Forscher.
(S E R V I C E - https://doi.org/10.1126/science.aea6425)
(Quelle: APA)