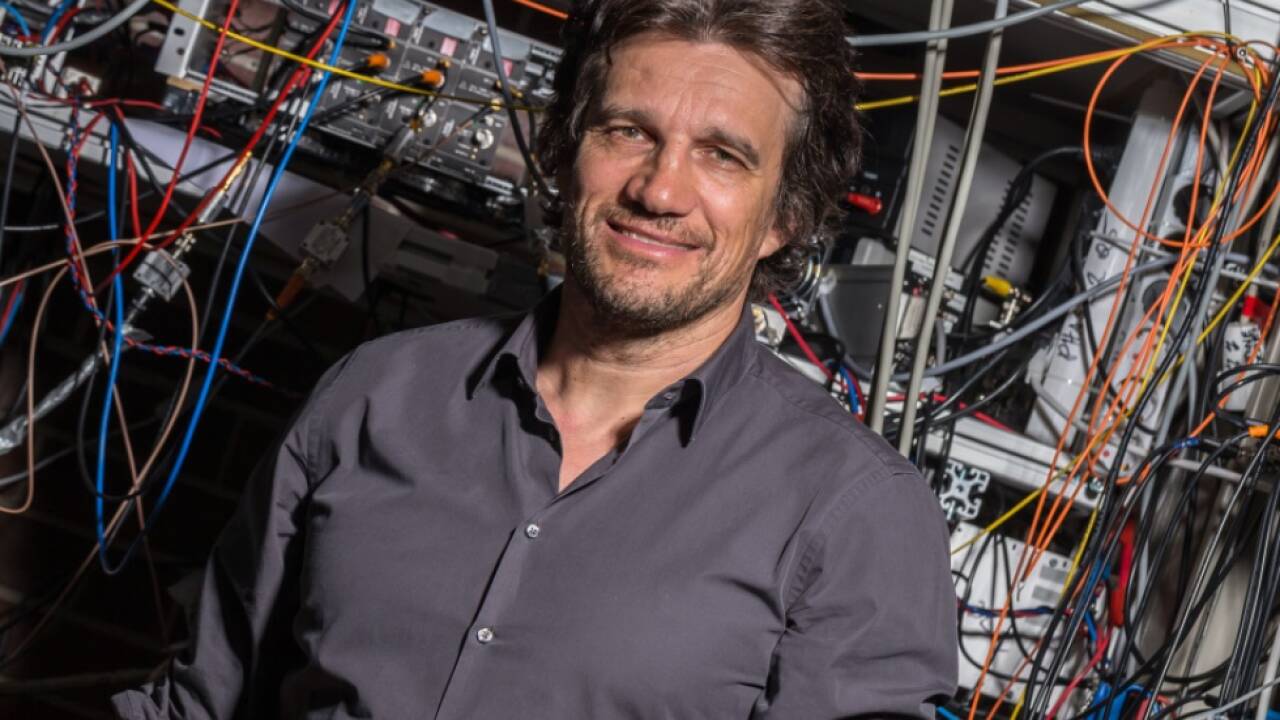Nägerl (58) ist wohl einer der höchstdekorierten Wissenschafter in Österreich. Der gebürtige Deutsche, der mit kurzer Unterbrechung seit 1995 an der Uni Innsbruck arbeitet, hat mit dem Start- und Wittgenstein-Preis (2003 bzw. 2017) des Wissenschaftsfonds FWF die zwei höchstdotierten österreichischen Forschungsförderpreise erhalten. Vom ERC wurde er zudem 2011 mit einem "Consolidator Grant", 2018 mit einem "Advanced Grant" und im Juni dieses Jahres mit seinem zweiten "Advanced Grant" ausgezeichnet.
"Kurz davor hinzuschmeißen"
Die Uni Innsbruck freute sich damals in einer Aussendung mit Nägerl, "einem der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der ultrakalten Quantenvielteilchensysteme", über diesen "höchstdotierten und prestigeträchtigsten europäischen Wissenschaftspreis", mit dem er seine Forschung zu ultrakalter Quantenmaterie vorantreiben wollte. Doch nun will der Physiker den "Advanced Grant" zurücklegen. "Mein Entschluss steht noch nicht 100-prozentig fest, ich bin aber kurz davor, das hinzuschmeißen", erklärte er im Gespräch mit der APA.
Was hinter dem Zerwürfnis steht, ist von außen schwer zu beurteilen. Ein Kernpunkt der Auseinandersetzung ist jedenfalls die Frage, wie lange Wissenschafterinnen und Wissenschafter an einer Universität beschäftigt sein können.
Für Nägerl ist der ERC-Förderpreis "in meiner Position die einzige Möglichkeit, mit dem Rektorat Konditionen auszuverhandeln", betonte er. Als "conditio sine qua non" forderte er eine über sein Pensionsantrittsalter mit 65 Jahren hinausgehende weitere Anstellung. Darüber hinaus wollte er zwei Stellen für seine Forschungsgruppe. Doch vom Rektorat sei ihm nur eine Doktorandenstelle sowie eine moderate Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt worden - für Nägerl ein inakzeptables Angebot, auch nach Nachbesserungen Anfang dieser Woche.
Der Physiker verweist auf seine Position an der Uni: "Ich bin hier in Innsbruck nach meiner Postdoc-Zeit aufgewachsen, bin nie als Professor berufen worden - habe daher auch nie Berufungsmittel bekommen", so Nägerl. Zudem sei er weder ein voller Professor nach altem Beamtenrecht, noch ein Angestellter, "sondern ein Zwitter, den es nur ein paar Mal in Österreich gibt: ein Beamter auf einer Stelle eines außerordentlichen Professors, der für seine Professorentätigkeit aufbezahlt wird, allerdings nicht ruhegenussfähig", so Nägerl. Als solcher müsse er mit 65 Jahren in Pension gehen.
Anstellung endet mit 65
Das trifft allerdings mittlerweile das Gros der Uni-Beschäftigten - die Emeritierung, bei der Professoren nach dem 65. Geburtstag noch drei Jahre bezahlt weiterarbeiten durften, ist ein Auslaufmodell. "Die Anstellung von Universitätsprofessorinnen und -professoren endet mit dem 65. Lebensjahr. Emeritierungen und damit die Möglichkeit noch über den Pensionsantritt an der Universität forschen und lehren zu können, sind gesetzlich nicht mehr vorgesehen", heißt es in einer der APA übermittelten Stellungnahme des Rektorats der Uni Innsbruck.
Nägerl sieht darin ein generelles Problem: "Meine Kollegen Rainer Blatt und Peter Zoller etwa waren Emeriti und in dieser Zeit noch extrem produktiv", sagte er. Eine Verlängerung könne auch "ein Anreiz sein, dass Leute auch nach 65 noch Gas geben und nicht gleich runterfallen in eine Pension, die noch dazu, u.a. aufgrund der Durchrechnung, nur die Hälfte dessen beträgt, was etwa Professoren in Deutschland bekommen, wenn sie in Pension gehen".
Eine weitere Beschäftigung eines pensionierten Forschers kann natürlich jederzeit über eine gesonderte Vereinbarung erfolgen. Andere Unis, die die APA kontaktierte, verweisen etwa auf die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung finanziert aus Drittmitteln, etwa wenn Projekte noch am Laufen sind. Das betont auch das Rektorat der Uni Innsbruck: Man biete drittmittelstarken Professorinnen und Professoren die Möglichkeit, sich mittels eingeworbener Projekte auch nach ihrer Pensionierung in den Forschungs- und Lehrbetrieb zu integrieren. "Dieses Vorgehen ermöglicht, Generationengerechtigkeit zu schaffen und jungen Talenten attraktive Perspektiven auf den frei werdenden Professuren zu bieten."
Physiker hat keine Geduld mehr
Nägerl verweist dagegen auf ihm bekannte Beispiele von Wissenschaftern, die nach Erreichen des Pensionsalters weiterbeschäftigt wurden, jüngst auch an seiner Universität, sagte er. Er argumentiert zudem damit, zwei Jahre nach Auslaufen seines fünfjährigen "Advanced Grants" in Pension gehen zu müssen. "Es kann nicht sein, dass ich in den nächsten fünf Jahren 2,5 Mio. Euro für ein Projekt ausgebe und eine Quantengasmaschine aufbaue, die ich dann noch zwei Jahre betreiben kann und dann wird das mit meiner Pensionierung in die Tonne getreten, weil das keiner übernimmt. Das kann man dem Steuerzahler gegenüber nicht vertreten, und aufgrund der fehlenden Perspektive auch meinen Doktoranden gegenüber nicht." Er habe Mitarbeiter, die wissen müssten, wie es weitergehe. "Seit Bekanntgabe des Advanced Grants sind bereits vier Monate vergangen, wenn die Uni mir jetzt nichts anbietet, muss ich mir etwas überlegen."
"Wäre großer Verlust"
Für die Rektorin der Uni Innsbruck, Veronika Sexl, "übersteigen die Forderungen von Herrn Nägerl den finanziellen Umfang der eingeworbenen Förderung deutlich. Er zählt bereits jetzt zu den Top-Verdienern an unserer Universität und findet hervorragende Forschungsbedingungen vor". Sie habe das Angebot Anfang dieser Woche "noch einmal im vertretbaren Rahmen erhöht. In finanziell schwierigen Zeiten sind unsere Möglichkeiten jedoch eingeschränkt". Es liege in ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Uni wirtschaftlich und sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehe.
Das Rektorat ist jedenfalls überzeugt, dass Nägerl sein ERC-Projekt unter den derzeitigen Rahmenbedingungen an der Uni Innsbruck sehr gut durchführen kann. "Für die Universität wäre es ein großer Verlust, wenn er seine ERC-Förderung zurücklegen würde", heißt es, man habe "alles versucht, um ihn von der Fortsetzung seiner erfolgreichen Arbeit an der Universität Innsbruck zu überzeugen".
Sollte Nägerl seinen Förderpreis tatsächlich zurücklegen, wäre das ein wohl einzigartiger Fall - zumindest in Österreich. Beim ERC betont man auf Anfrage der APA, bisher "keine relevanten Daten zu ähnlichen Fällen" zu haben. Wenn es sie gebe, dürften solche Fälle aber eher selten sein, verweist man auf das Mitnahmerecht der ausgezeichneten Forscher. Denn ERC-Grants können an eine andere Gastinstitution im In- oder Ausland mitgenommen werden.