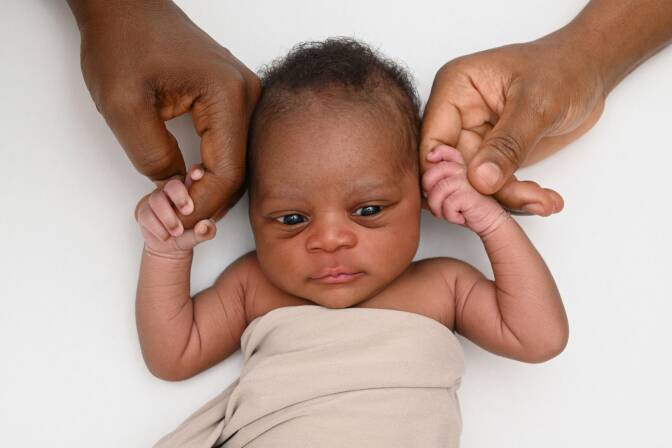Die Zeiten ändern sich und mit ihnen der Umgang mit Personen, Denkmälern und Ereignissen. Denn: "Die Sinnhaftigkeit eines ehrenden oder mahnenden Gedenkens ist nicht unendlich gegeben", betont Yvonne Wasserloos von der Universität Mozarteum Salzburg. Die deutsche Musikwissenschafterin hat gemeinsam mit ihrer Fachkollegin Bernadeta Czapraga das Symposion "In honour of - Kulturen des Erinnerns und Gedenkens" veranstaltet. Wie es zu der Tagung kam? "Das hat mit der politischen Lage der Gegenwart zu tun: Die Themen Nationalsozialismus und Rechtsextremismus sind 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg leider wieder brandaktuell", betont Wasserloos. In ihrem Einführungsvortrag zeigte sie auf, was Prozesse der Veränderung für reale wie imaginäre, stumme wie klingende Orte der Erinnerung und der Ehrung bedeuten, sobald diese mit einer neuen oder anderen Lesart aufgeladen werden.
Am Beispiel des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1809- 1847) erläutert die Musikwissenschafterin das Phänomen "gebrochener Traditionen". Der im 19. Jahrhundert berühmte und gefeierte Komponist wurde von Richard Wagner und später durch die Nationalsozialisten antisemitisch verfemt: "Da fand ein Wertewandel statt, Mendelssohn Bartholdy war plötzlich nicht mehr Teil der deutschen Kulturgeschichte, seine Denkmäler wurden abgerissen oder eingeschmolzen - auch zu Kriegsmunition übrigens." In jüngerer Vergangenheit sind in Deutschland wieder mehrfach Mendelssohn-Denkmäler aufgestellt worden. Gedenken im öffentlichen Raum sei, sagt Wasserloos, nicht unendlich, da sich entsprechende politische Werte verändern.
Was kann Erinnerungskultur - auch mithilfe des Mediums Musik - nun leisten? Im Rahmen ihres Arbeitsschwerpunktes "Musik und Macht" am Mozarteum veranstaltet Wasserloos alljährlich am 27. Jänner, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, unter dem Titel "Erinnerungsorte" Konzerte und Lesungen. Zu hören sind Werke von im NS-Regime verfolgten und ermordeten Kunstschaffenden - heuer etwa von Ilse Weber, Victor Ullmann oder Pavel Haas. Alle drei waren 1944 im KZ Auschwitz ermordet worden. "Die Künste bieten Orte der Erinnerung, die die Vergangenheit ästhetisch und emotional wachhalten und vergegenwärtigen", sagt die Wissenschafterin. So entstehen immaterielle wie materielle Orte des Gedenkens.
Die aktuell verbreitete Cancel Culture zeige, wie gewisse Dinge durch neues Wissen, aber auch durch einen anderen Blick auf die Welt neu bewertet werden. Wasserloos verweist etwa auf die Straßennamen-Problematik. Wie soll man da vorgehen? "Wenn man etwas vollständig abschafft, löscht man auch einen Teil der Geschichte. Erinnerungsorte sind auch Lernorte. Den Namen zu belassen, ihn aber mit einer Kontextualisierung zu versehen ist bisweilen sinnvoller."
Auf der Salzburger Tagung kam auch die Aktion "Stolpersteine" des Kölner Künstlers Gunter Demnig zur Sprache. Mehr als 90.000 Gedenksteine wurden in dieser Initiative bereits europaweit verlegt, allein in der Stadt Salzburg sind es 517. Dieses Projekt, das auf quadratischen, mit Messing überzogenen Steinen an Biografien von NS-Opfern erinnert, richtet sich gegen das Vergessen von Einzelschicksalen.
Die Musikwissenschafterin Anna Fortunova wiederum thematisierte das kollektive Erinnern an die Dirigenten Herbert von Karajan und Leonard Bernstein. Mithilfe von Video-, Bild- und Textbeispielen belegte die Forscherin, wie die beiden Künstler ihr Selbstbild inszenierten. Yvonne Wasserloos: "Bernstein präsentierte sich als Good Guy, als netter Nachbar, der sich schnell solidarisiert und mit allen kommuniziert. Karajan hingegen versuchte, sich elitär abzuheben, wirkte distanziert." Er habe nicht selten - auch im Umgang mit Stars wie dem Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin - das Lehrmeisterhafte betont. Die Eigenvermarktung Karajans setze sich heute bei diversen Merchandisingprodukten für "Karajanisten" fort - die Seitenansicht des Salzburgers beim Dirigieren fungiert dabei als Markenzeichen.
Der in Wien lehrende Musikwissenschafter Fritz Trümpi berichtete indessen von der "philharmonischen Schuldabwehr": Der "Anschluss" Österreichs an Nazideutschland 1938 bedeutete für zahlreiche Musiker, auch aus den Reihen der Wiener Philharmoniker, eine existenzielle Bedrohung. Großteils aus "rassischen" und in einigen wenigen Fällen aus politischen Gründen wurden sie aus dem Orchester vertrieben, waren gezwungen, in das Exil zu fliehen, oder wurden in ein KZ deportiert und dort ermordet. Als jene Musiker, die den Holocaust überlebten, nach 1945 mit dem Orchester wieder in Kontakt zu treten versuchten, wurden sie vom Orchesterkollektiv abgewiesen. Ein Verhalten, das von der Sozialforschung als "Schuldabwehr" beschrieben wird. "Die Schädigung, die jüdische Musiker durch ihre Vertreibung bereits erlitten hatten, setzte sich nach dem Krieg fort", sagt Yvonne Wasserloos. Für sie gab es keine faire Behandlung, der Versuch, finanzielle Ansprüche geltend zu machen, scheiterte meist. Der alte (Un-)Geist wirkte weiter.