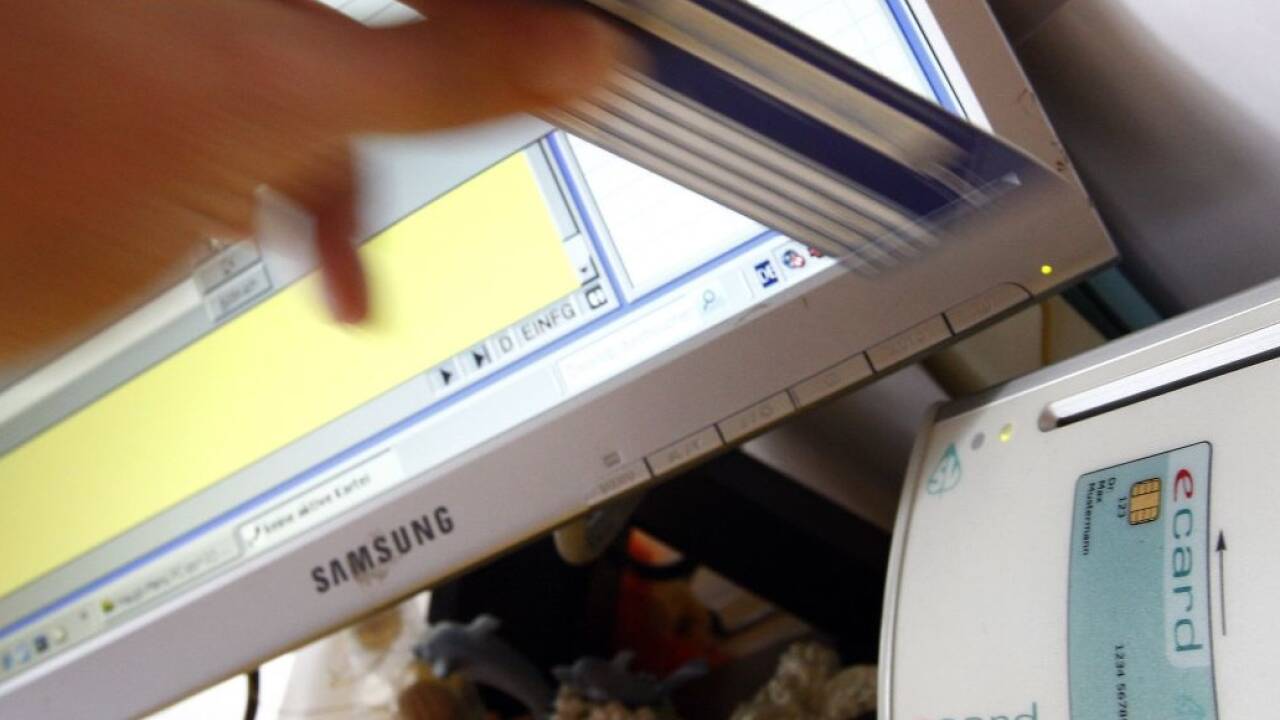Ab 2019 sollen Wissenschafter im In- und Ausland auf staatliche Datenbanken zugreifen und die dort gespeicherten Informationen auswerten dürfen. Das gilt auch für kommerzielle Forschung. Geregelt ist das in einer Novelle zum Forschungsorganisationsgesetz. Demnach müssen die Namen der betroffenen Bürger durch ein Personenkennzeichen ersetzt werden, um eine persönliche Zuordnung ihrer Daten zu verhindern. Von der APA befragte Datenschützer gehen aber davon aus, dass eine Re-Identifizierung der Daten weiterhin möglich bleibt.
Eine genaue Liste der zu öffnenden Datenbanken - in Frage kommen etwa medizinische Register, Personenstands- und Melderegister sowie Daten von Sozialversicherungen und AMS - gibt es noch nicht. Diese müsste erst durch Verordnungen erstellt werden. Explizit angedacht ist im Gesetz aber auch die Freigabe der elektronischen Gesundheitsakte ELGA. Dies will Gesundheitsministerin Hartinger-Klein verhindern, wie sie nach Bekanntwerden der Pläne am Mittwoch sagte.
"Wie im ELGA-Gesetz geregelt, werden auch künftig nur die Patienten selbst und ausschließlich die tatsächlich behandelnden Ärzte ELGA-Daten abfragen dürfen", sagte die Ministerin und forderte einen entsprechenden Abänderungsantrag zum Gesetz im Parlament.
Pikant ist das auch deshalb, weil die Regierung das Gesetz bereits am 21. März beschlossen hat - damals ohne Veto Hartinger-Kleins. Schon in der Begutachtung hatte es scharfe Kritik von Datenschützern und Arbeiterkammer gegen die Pläne gegeben. Auch die Datenschutzbehörde im Justizministerium äußerste sich kritisch und sieht Teile des Gesetzes als EU-rechtswidrig an. Begrüßt wird das Vorhaben dagegen von Universitäten, Industrie und Wirtschaft. Ob es die von der FPÖ-Ministerin gewünschte Änderung wirklich geben wird, ist nach Angaben des ÖVP-Klubs offen. "Das ist Work in Progress", hieß es Mittwoch auf APA-Anfrage. Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will am Freitag Stellung nehmen.
Scharfe Kritik an den Plänen kam umgehend von der Ärztekammer. "Jetzt kann man den Patienten nur empfehlen, aus ELGA auszutreten", sagte Vizepräsident Harald Mayer. Thomas Lohinger von der Datenschutzorganisation epicenter.works warnte angesichts des Facebook-Datenskandals vor Missbrauch: "Hochsensible Gesundheitsdaten für globale Marktforschungszwecke zu öffnen, ist eine ganz schlechte Idee. Die Cambridge Analyticas dieser Welt können einzelne Personen leicht in den mangelhaft anonymisierten Daten wiederfinden."
Auch ein von der APA befragter Experten aus dem Uni-Bereich warnte, dass das Gesetz zu wenig Hürden gegen Missbrauch enthalte. "Es war ein Wunschkonzert der Uni-Vertreter und Lobbygruppen", sagt er gegenüber der APA. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung plädierte dagegen für die Beibehaltung der Pläne und warnte vor einer Gefährdung des Wirtschaftsstandortes.
Skeptisch sehen das Gesetz auch NEOS und Liste Pilz. Für Liste Pilz-Klubchef Peter Kolba ist die Weitergabe persönlichster Daten durch die Regierung "ungeheuerlich". NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon kritisierte auch die Vorgehensweise der Koalition, mehr als ein Dutzend Datenschutz-Gesetze gleichzeitig ins Parlament zu schicken. "Wir sind mit Gesetzen geflutet worden", die nun rasch durchs Parlament gepeitscht würden, so Gamon.
Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) hingegen warnte vor einer Gefährdung des Forschungs- und Innovationsstandortes bei der Umsetzung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes. Dieses sei "ein wesentlicher Bestandteil, um eine Absicherung der universitären und außeruniversitären Forschung in Österreich zu ermöglichen", so RFT-Vorsitzender Hannes Androsch in einer Aussendung.
Ziel des Datenschutz-Anpassungsgesetzes für Wissenschaft und Forschung müsse die Schaffung einer "ausgewogenen Balance zwischen bestmöglichem Schutz personenbezogener Daten einerseits und klaren Rahmenbedingungen für den Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort Österreich andererseits sein", betonte Androsch. Vor allem die Frage der Registerforschung sei von Bedeutung: "Diese sollte nicht durch die Herausnahme einzelner Bereiche verwässert werden."
Eine unverhältnismäßig schwierige Auskunftserteilung würde die Forschungsarbeit "erheblich bürokratisieren und eine signifikante Verlangsamung der Prozesse bewirken", so der Rat. Jede inhaltliche Einschränkung der Ergebnisoffenheit in der Grundlagenforschung würde zu einem "de-facto-Verbot führen".