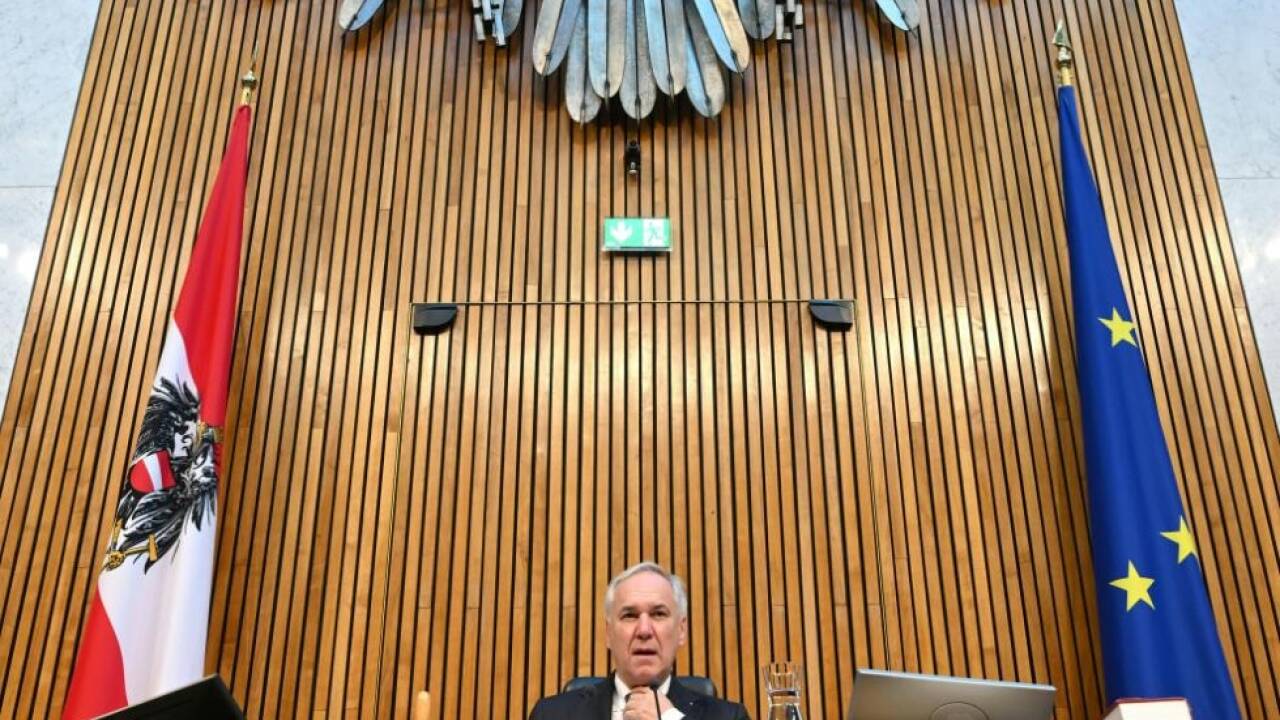Rosenkranz hob in seinem Eingangsstatement hervor, dass die Neutralität Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg die Freiheit gesichert und vor einer Teilung bewahrt habe. Für die Neutralität habe Österreich zudem Garantieerklärungen durch die vier Hauptsiegermächte des Krieges bekommen, darunter auch die Sowjetunion als Vorgängerstaat Russlands. "Wie sieht es heute mit dieser Garantie aus, weil beide Seiten dieser Medaille gehören zusammen", sagte Rosenkranz mit Blick auf die Neutralität, die es aus seiner Sicht offenbar für ein weiteres Wohlverhalten der Siegermächte zu wahren gilt.
"Einiges an Terrain verloren"
Österreich habe sich im Jahr 1955 für die Neutralität entschieden "mit der Absicht, Friedensstifter in der Welt zu sein", so Rosenkranz. Heute würden Friedensverhandlungen aber in Ländern wie Ungarn stattfinden, was zeige, "dass wir da einiges an Terrain verloren haben. Daran sollte man arbeiten, dass dieser Status wieder erreicht wird."
Der FPÖ-Politiker betonte, dass die österreichische Neutralität nach dem Schweizer Vorbild gestaltet wurde. "So richtig daran gehalten hat man sich aber von Anfang an nicht." Daher solle in der Veranstaltung mit Politikern, Juristen und Verteidigungsexperten aus beiden Ländern herausgearbeitet werden, "was denn eigentlich das Schweizer Muster ist".
Schweizer Spitzenbeamter sieht Sky Shield "problemlos" mit Neutralität vereinbar
Die Veranstaltung zeigte deutlich, dass die Schweizer ihre Neutralität eher pragmatisch sehen. Während der Völkerrechtler Peter Hilpold und die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst die Vereinbarkeit der österreichischen Neutralität mit der Sky-Shield-Initiative infrage stellten, äußerten sich Riniker und der Schweizer Spitzenbeamte Joachim Adler in Bezug auf ihr Land entspannt.
Die mit Sky Shield verbundenen Ziele "sind aus Schweizer Sicht problemlos mit der Neutralität vereinbar", betonte der Chef für Verteidigungspolitik im Schweizer Verteidigungsministerium. Es gehe nämlich nur um Beschaffung und Interoperabilität im Ernstfall, "und wir können jederzeit den Stecker ziehen, wenn uns mulmig wird mit der Vereinbarkeit", so Adler. Er betonte, dass die Neutralität flexibel gehandhabt werden müsse. "Je starrer die Neutralitätspolitik, desto schwieriger wird es, sie der Lage anzupassen, desto größer wird die Gefahr, dass sie ihren Wert verliert."
"Gute Verteidigungsstrategie ohne internationale Zusammenarbeit nicht denkbar"
Riniker unterstrich, dass die Schweiz die Neutralität lediglich "als Mittel unserer Außenpolitik" ansehe. Sie solle dem Staat möglichst viele Handlungsmöglichkeiten geben, bedeute aber nicht Gleichgültigkeit gegenüber jenen, die das Völkerrecht verletzen. Deshalb habe sich die Schweiz auch an den Sanktionen gegen Aggressor Russland beteiligt.
Die liberale Politikerin machte klar, dass sich die Schweiz militärisch alleine nicht verteidigen könne. "Eine gute Verteidigungsstrategie ist ohne internationale Zusammenarbeit nicht denkbar." Deshalb kooperiere man mit der NATO und lehne die von der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) betriebene Neutralitätsinitiative ab, weil diese den Handlungsspielraum des Landes einengen würde. "Wir müssen uns bewusst sein, dass Neutralität kein automatisches Schutzschild ist."
Die Genfer Historikerin Irène Herrmann zeichnete in ihrem Vortrag die Wandlungen der fast 200-jährigen Schweizer Neutralität nach. So habe die Eidgenossenschaft nicht immer die völkerrechtlichen Regeln eingehalten, etwa durch Finanzgeschäfte mit NS-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. "Nach 1945 stand die Schweiz daher auf der Seite der moralischen Verlierer."
Völkerrechtler Hilpold sieht EU-"Friedensfazilität" kritisch
In den Beiträgen der österreichischen Experten wurde vor allem die Beteiligung an der EU-Verteidigungspolitik erörtert. So betonte Hilpold, dass Österreich sich finanziell gleichberechtigt an der "Friedensfazilität" beteiligt, mit der unter anderem Waffen für die Ukraine angeschafft werden. "Es macht aus neutralitätsrechtlicher Sicht wenig Unterschied, wenn ein bestimmter Betrag für Waffen oder für Verbandsmaterial zur Verfügung gestellt wird", sagte der Völkerrechtler.
Der frühere Generalstabschef und Ex-EU-Spitzengeneral Robert Brieger sprach diesbezüglich von einem "Spannungsfeld", das es aber mit einem Kompromiss aus Solidarität und Neutralität aufzulösen gelte. Doch sei es eine "offene Frage", wie lange die Neutralität angesichts der zunehmenden Vernetzung in der EU-Verteidigungspolitik haltbar bleibe. Dies gelte etwa, wenn die EU künftig zunehmend auch Aufgaben der territorialen Verteidigung anstelle der NATO übernehmen werde.
Neutralität für SPÖ "strategischer Vorteil" innerhalb der EU
In der anschließenden Podiumsdiskussion bekräftigten Spitzenvertreter der fünf Parlamentsparteien ihre jeweiligen Positionen. Fürst betonte, dass Österreich "mehr denn je auf unserer Neutralität beharren" müsse und forderte eine Volksabstimmung über Sky Shield. Gemeinsam mit der Schweiz solle man "eine kleine mitteleuropäische Oase" schaffen, die der Welt den Beitrag der Neutralität vermitteln könne.
"Wenn wir uns Neutralität im strengsten Sinne ausdenken, bedeutet das Isolation, bedeutet das Austritt aus der Europäischen Union", konterte der Grüne Verteidigungssprecher David Stögmüller. Sein SPÖ-Kollege Robert Laimer bezeichnete es als "strategischen Vorteil", dass Österreich das einzige neutrale EU-Mitglied auf dem Kontinent sei und sprach sich für eine "aktive Neutralitätspolitik" aus. ÖVP-Mandatar Friedrich Ofenauer sagte, dass sich Österreich verteidigungspolitisch auf EU-Ebene schon jetzt rechtlich stärker einbringen könne "als wir politisch wollen. Daran gilt es zu arbeiten."
NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sagte, dass Politiker "nicht nur auf Umfragen schielen", sondern die Bevölkerung von einer Vision überzeugen sollten. "Das tun wir. Wir sehen die Zukunft nur in einem starken Europa", bekräftigte er das Eintreten seiner Partei für eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik unter Beteiligung Österreichs.