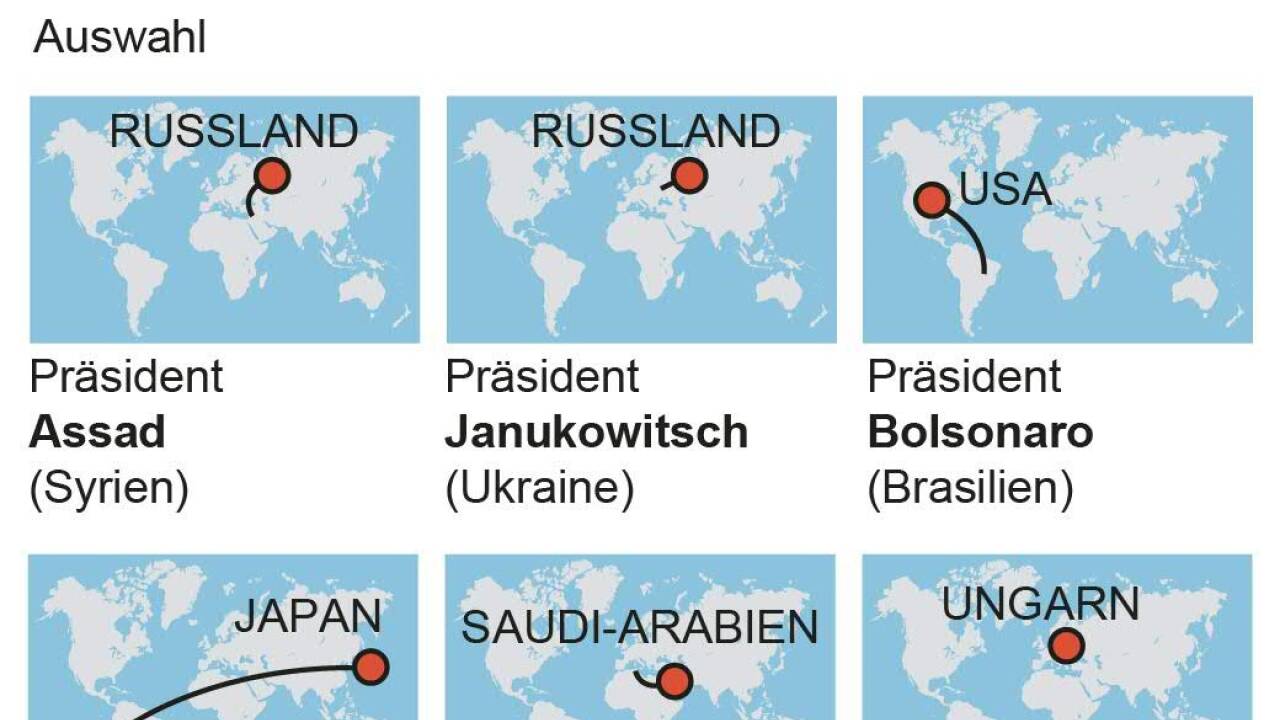Der Vormarsch islamistischer Rebellen in Syrien samt der Einnahme der Hauptstadt Damaskus hat Machthaber Bashar al-Assad dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Er ist nach Moskau geflogen. Er und seine Familie sollen in Russland "aus humanitären Gründen" Asyl erhalten. Er war in der Nachfolge seines im Jahr 2000 verstorbenen Vaters Hafez al-Assad fast 25 Jahre am Ruder eines säkularen Polizei- und Geheimdienstregimes in Syrien. Die letzten fast 14 Jahre hatte sich Bashar al-Assad mit Unterstützung Russlands und des Irans trotz Bürgerkriegs an der Staatsspitze gehalten. Ausgelöst hatten den Bürgerkrieg Anti-Regierungsproteste im März 2011, die Assad blutig niederschlagen ließ. Im Folgenden eine Auswahl an Fällen anderer Staats- und Regierungschefs, die in der jüngeren Vergangenheit nach Umstürzen oder wegen Vergehen während ihrer Amtszeit ihre Länder verlassen mussten:
Ukrainischer Präsident Janukowitsch in Russland
Der Russland-freundliche Viktor Janukowitsch wurde 2010 zum Präsidenten gewählt. Was folgte, war die Einschüchterung der politischen Gegner und der kritischen Presse, zahlreiche Verhaftungen von Oppositionellen, Korruption und kein bergauf bei der Bekämpfung der Armut in der breiten Bevölkerung. Janukowitsch nahm Verhandlungen mit der EU über ein Handels- und Assoziierungsabkommen auf.
Als er diese zugunsten eines Milliardenkredits von Russland Ende 2013 stoppte, schlugen die Massenproteste dagegen im Jahr darauf auf dem Maidan-Platz in Kiew in Gewalt um. Dutzende Demonstranten wurden getötet. Die Opposition forderte den Rücktritt Janukowitschs. Das Innenministerium erklärte, es unterstütze zusammen mit der Polizei die Opposition. Armee und Geheimdienst schlossen sich an. Im Februar stimmte das Parlament für die Amtsenthebung des Präsidenten und eine Neuwahl. Janukowitsch floh aus der Ukraine nach Russland und wurde vom Parlament für abgesetzt erklärt.
Nordmazedonischer Premier Gruevski in Ungarn
Der Nationalkonservative Nikola Gruevski war von 2006 bis 2016 Regierungschef, als sein Land noch Mazedonien hieß. Zwei Jahre nach seiner Amtszeit wurde er wegen Korruption rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt, der er sich durch die Flucht nach Ungarn entzog. Dort erhielt er umgehend politisches Asyl.
Mit dem rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verbindet ihn eine enge politische Freundschaft. Seine Flucht durch mehrere Balkanstaaten hatten Mitarbeiter des ungarischen Geheimdienstes organisiert. Gruevski führt in Budapest ein von der Öffentlichkeit abgeschirmtes Leben. Außenminister Péter Szijjártó hat erklärt, dass er Gruevski regelmäßig zu Gesprächen bei sich empfange. Gruevski hat in Ungarn eine Consulting- und Handelsfirma gegründet.
Italienischer Premier Craxi in Tunesien
Der Sozialist Bettino Craxi stand von 1983 bis 1987 der Regierung in Rom vor. 1993 trat er als Parteichef zurück. Im Jahr davor war er ins Visier der Anti-Korruptionsermittlungen "Mani Pulite" geraten. Er wurde in der Folge zum Symbol einer verschwenderischen politischen Führungselite, die sich mit Schwarzgeldern und illegaler Parteienfinanzierung bereicherte. Craxi erklärte sich als zu Unrecht verfolgt, weil er doch nur das getan habe, was alle anderen auch getan hätten, und lehnte es ab, sich für seine Taten zu entschuldigen. 1994 flüchtete er nach Tunesien. In seiner Abwesenheit verurteilte ihn ein Gericht in Italien zu insgesamt mehr als 28 Jahren Haft. In seiner Villa in Hammamet erlag der Diabetiker im Jahr 2000 einem Herzinfarkt.
DDR-Staats- und Parteichef Honecker in Chile
Nach der Palastrevolte gegen seinen Vorgänger Walter Ulbricht 1971 versammelte Erich Honecker alle höchsten Ämter in seiner Person. Als sich mit Massenprotesten die Wende abzeichnete, wurde er am 18. Oktober 1989 vom Machtzirkel um sich gezwungen, seinen Rücktritt zu verlesen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands floh der gesundheitlich Angeschlagene im März 1991 nach Moskau. Dort suchte er Schutz in der chilenischen Botschaft. Im Jahr darauf landete der per Haftbefehl Gesuchte nach seiner Auslieferung an Deutschland im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Der Prozess gegen ihn wegen der Todesschüsse an der Grenze DDR-BRD wurde eingestellt, weil er an Krebs erkrankt war. Nach Aufhebung des Haftbefehls 1993 ging Honecker zu seiner Frau Margot ins Exil nach Chile, wo er 1994 im Alter von 81 Jahren starb.
Bangladeschische Premierministerin Hasina in Indien
Justiz und Übergangsregierung in Bangladesch versuchen die Auslieferung der heuer im August wegen Massenprotesten zurückgetretenen und nach Indien geflohenen Ex-Regierungschefin Sheikh Hasina zu erwirken. Ihre Regierung war zuvor gegen wochenlange Massenproteste mit Polizeigewalt vorgegangen. Mehr als 700 Menschen wurden getötet. Hasina regierte Bangladesch mit Unterbrechungen insgesamt 20 Jahre lang, zuletzt ab 2009. Ihrer Regierung werden Menschenrechtsverletzungen bis hin zur unrechtmäßigen Inhaftierung und Tötung Oppositioneller vorgeworfen. Hasina ist die älteste Tochter des Staatsgründers Sheikh Mujibur Rahman. Nachdem ein Großteil ihrer Familie bei einem Militärputsch 1975 ermordet worden war, war sie danach schon einmal zwischenzeitlich im indischen Exil.
Pakistanische Premierministerin Bhutti in Großbritannien und Dubai
Die Tochter von Präsident und Premier Zulfikar Ali Khan Bhutto war ebenfalls gleich mehrmals Regierungschefin (1988-90 und 1993-96) und auch gleich zweimal im Exil (1984-88 und 1999-2007). Als das Militär den Vater 1977 absetzte und später hinrichtete, durfte Benazir Bhutto als Oppositionsführerin schließlich ausreisen. Als es wieder freie Wahlen in Pakistan gab, wurde Bhutto erste Frau an der Regierungsspitze eines muslimischen Landes. In ihrer zweiten Amtszeit mehrten sich in Krisenzeiten Vorwürfe der Machtarroganz und des Machtmissbrauchs.
Nach einer Verurteilung wegen Korruption ging Bhutto nach Dubai, um sich der Haftstrafe zu entziehen. Als sie innerhalb eines Deals mit Militärmachthaber Pervez Musharraf wieder Premierministerin werden wollte und im Triumph zurückkehrte, wurden bei einem Selbstmordanschlag gegen sie fast 140 Menschen getötet, sie selbst überlebte. Ein späteres Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung, bei dem der Täter in die Menge schoss und dann sich in die Luft sprengte, überlebte sie nicht.
Peruanischer Präsident Fujimori
Zehn Jahre war Alberto Fujimori Staatschef, da setzte er sich im November 2000 nach seiner von Betrug geprägten Wiederwahl nach Japan ab. Da er auch die japanische Staatsbürgerschaft besaß, wurde er nicht nach Peru überstellt. 2005 reiste er aber nach Chile, das ihn auslieferte. Dort wurde er wegen Menschenrechtsverbrechen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. 2017 wurde der damals 79-Jährige von seinem Nachfolger Pedro Pablo Kuczynski in einem höchst umstrittenen Schritt begnadigt. Ein Deal des Präsidenten über einen Pakt zur Erreichung von Mehrheit im Parlament soll im Hintergrund gestanden sein. Fujimori galt zugleich als unheilbar herzkrank. Ein jahrelanger Rechtsstreit entbrannte um die Amnestie. 2023 erfolgte die Freilassung, einer angekündigten, erneuten Präsidentschaftskandidatur kam der Tod des 86-Jährigen heuer im September zuvor.
Afghanischer Präsident Ghani in den Emiraten
Ashraf Ghani amtierte seit 2014, als er 2021 dem Vormarsch und der erneuten Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban zum Opfer viel. Die US-geführten internationalen Truppen in Afghanistan setzten der Eroberung Kabuls nichts entgegen und zogen ab. Der Politologe musste fliehen und fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten Aufnahme.
Thailändischer Premier Shinwatra in Dubai
2023 kehrte Thaksin Shinwatra nach 15 Jahren selbst gewählten Exils, die er vor allem in Dubai verbrachte, nach Hause zurück. Er wurde wie ein Rockstar empfangen. Der Unternehmer und Populist war Parteigründer und Regierungschef von 2001 bis 2006. Nach Protesten der Opposition wegen Korruptionsvorwürfen und einer umstrittenen Neuwahl setzte das Militär Thaksin ab. Nach einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs 2008 verließ Thaksin Thailand, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Seit seiner Rückkehr sieht sich der mit einem Politikverbot belegte Thaksin weiterhin mit vielen Justizproblemen konfrontiert.
Tunesischer Präsident Ben Ali in Saudi-Arabien
Zine El Abidine Ben Ali, Staatschef ab 1987, war der erste Machthaber, der im Zuge der Aufstände in arabischen Ländern 2011 ("Arabischer Frühling") von Massenprotesten aus dem Amt gejagt wurde. Der Autokrat floh nach Saudi-Arabien. Dort starb er 2019. Die tunesische Justiz hatte ihn in Abwesenheit zu mehreren, langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Sri-Lanka-Präsident Rajapaksa in Singapur
Zuvor Premier, wurde Mahinda Rajapaksa 2005 zum Präsidenten gewählt. 2009 konnte er nach dem Sieg der Armee den 26-jährigen Bürgerkrieg gegen die separatistische Guerilla Befreiungstiger von Tamil Eelam (LLTE) beenden. Daraufhin wurde er wiedergewählt; zugleich gab es Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkrieg. 2015 wurde er abgewählt, 2019 ermöglichte ihm die Wahl seines Bruder ein Comeback als Premier. Doch 2022 versank Sri Lanka in einer Wirtschaftskrise. Unter dem Druck der Straße trat er zurück. Obwohl er auf Basis einer Gerichtsentscheidung nicht hätte ausreisen dürfen, schaffte er es nach Singapur.
Brasilianischer Präsident Bolsonaro in den USA
Der Ultrarechte begab sich nach seiner Abwahl und kurz vor der Angelobung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva samt Frau und Tochter in die USA. Laut Medienberichten wollte er die italienische Staatsbürgerschaft erlangen, um künftig in Italien zu leben, um so einer möglichen Haftstrafe zu entgehen. Eine Woche nach der Amtseinführung von Lula, stürmten Bolsonaro-Anhängern in Brasília staatliche Stellen und verwüsteten sie. Jair Bolsonaro bestreitet, seine Hand im Spiel gehabt zu haben. Im März diesen Jahres kehrte er nach Brasilien zurück. Die Justiz untersucht das jetzt offiziell neben Ermittlungen in anderen Causen.
Schah von Persien in Ägypten
Zu einer Odyssee geriet die Exilierung von Schah Mohammad Reza Pahlavi nach der Islamischen Revolution im Iran 1979. Der eng mit den USA verbündete Schah war unter dem Druck von gewaltsamen Protesten gegen seine Herrschaft 1979 aus dem Iran geflüchtet. Der Ayatollah Ruhollah Khomeini kehrte aus Frankreich in die Heimat zurück und ersetzte die Monarchie durch einen islamischen Gottesstaat. Der Schah floh nach Ägypten, dann Marokko, auf die Bahamas und nach Mexiko. Krebskrank, wollte er sich in den verbündeten USA behandeln lassen. Als er dazu in New York eintraf und es hieß die Vereinigten Staaten gewährten ihm Zuflucht, kam es zur Erstürmung der US-amerikanischen Botschaft in Teheran durch iranische Studenten und zur monatelangen Geiselnahme der Botschaftsangehörigen. Nach seiner Behandlung musste Pahlavi auf Druck der US-Regierung das Land verlassen. Er starb 1980 im ägyptischen Exil in Kairo.
Dalai Lama in Indien
Der Dalai Lama, einst geistliches und weltliches Oberhaupt der Tibeter, hat seine Heimat seit 1959 nicht gesehen. Der schwer zugängliche buddhistische Klosterstaat Tibet war von 1720 bis 1912 chinesisches Protektorat und nach dem Ende des chinesischen Kaisertums faktisch selbstständig. 1950/51 marschierten chinesische kommunistische Truppen in Tibet ein. 1959 nach der Niederschlagung des großen Volksaufstands gegen die Chinesen floh der 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso mit über 100.000 Landsleuten über die Grenze nach Indien. In der Stadt Dharamsala hat die Exil-Regierung bis heute ihren Sitz. 2011 trat der Dalai Lama als politisches Oberhaupt seines Volkes zurück und übergab den Stab der weltlichen Macht an eine gewählte Regierung.
Kaiser Karl in Portugal
Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ließ sich der Zerfall der Donaumonarchie nicht aufhalten. Nach seinem Verzicht auf Ausübung der Regierungsgeschäfte vom 11. November 1918 wurde Kaiser Karl auf Beschluss der Nationalversammlung seiner Herrscherrechte und sonstigen Vorrechte verlustig erklärt und des Landes verwiesen. Er reiste in die Schweiz aus. Nach zwei misslungenen Versuchen, die Monarchie zumindest in Ungarn wiederherzustellen wurde der Habsburg von den Siegermächten des Weltkriegs 1921 auf die portugiesische Insel Madeira verbannt, wo er am 1. April 1922 verstarb.
Ungarischer Reichsverweser Horthy in Portugal
Der ehemalige k.u.k. Admiral Miklós Horthy (1868-1957) führte Ungarn nach der Niederschlagung der Ungarischen Räterepublik 1920-1944 als Reichsverweser - man sprach damals auch von einem "Königreich ohne König mit einem Admiral ohne Meer". Im Zweiten Weltkrieg galt Ungarn als verlässlicher Bündnispartner Hitler-Deutschlands, das ab März 1944 auch Truppen im Land stationierte. Im Oktober 1944 versuchte Horthy jedoch, sein Land aus dem Bündnis mit Deutschland herauszulösen und einen Separatfrieden mit den vorrückenden Alliierten zu erreichen. Die dilettantisch vorbereitete Aktion scheiterte; auf Druck der Deutschen, die zudem seinen Sohn Miklós jun. entführt hatten, dankte Horthy ab. Er wurde zunächst in einem Schloss bei Weilheim in Bayern interniert und dort im Mai 1945 von den heranrückenden US-Truppen gefangen genommen. Nach dem Krieg wurde ihm bald klar, dass er keine weitere politische Rolle in Ungarn mehr spielen würde. Er ging mit seiner Frau nach Portugal ins Exil, wo damals der mit ihm sympathisierende Diktator António Salazar herrschte. Horthy starb 1957 in der portugiesischen Küstenstadt Estoril. Nach dem Ende des Kommunismus wurde der Leichnam des bis heute umstrittenen Reichsverwesers nach Ungarn überführt und 1993 in seinem Heimatort Kenderes bestattet.
Ugandischer Präsident Idi Amin in Saudi-Arabien
Der ugandische Staatschef Idi Amin, dessen Regime (1971-79) zu einem der blutigsten der afrikanischen Geschichte zählte, fand nach seiner Vertreibung Zuflucht in Saudi-Arabien, wo er 2003 starb.
Äthiopischer Präsident Mengistum in Simbabwe
Im Mai 1991 trat der äthiopische Staatschef Mengistu Haile Mariam nach Niederlagen im Bürgerkrieg zurück und flüchtete zunächst nach Simbabwe, mit dessen Machthaber Robert Mugabe er befreundet war. 1999 suchte er Exil in Nordkorea und später wieder in Simbabwe, wo er noch heute lebt. 2006 wurde Mengistu u. a. wegen Völkermord, Totschlag und Unterschlagung in Abwesenheit schuldig gesprochen.
Von Haiti nach Frankreich
Der berüchtigte "Glamour-Diktator" - Zitat: 2Es ist das Schicksal der Menschen von Haiti zu leiden" - lebte bis zu seiner überraschenden Rückkehr in die Heimat 2011 fast 25 Jahre lang im französischen Exil. Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier, der 1971 die Nachfolge seines Vaters François "Papa Doc" Duvalier angetreten hatte, hatte sich im Februar 1986 nach monatelangen Unruhen nach Frankreich abgesetzt. Zuvor hatten die USA ihre schützende Hand weggezogen. "Baby Doc" war nur kurz wegen Korruption und Veruntreuung in Haft. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, illegalen Verhaftungen, Folter, politischen Morden wurde er nicht zur Rechenschaft gezogen, ehe er 2014 in Port-au-Prince an Herzversagen starb.
Von den Philippinen nach Hawaii
Nach gewaltfreien Protesten der philippinischen Bevölkerung gab der damals seit über 20 Jahren autoritär regierende Staatschef Ferdinand Marcos 1986 die Inselgruppe auf. Er starb 1989 im Exil auf Hawaii (USA). Seit 2022 ist sein Sohn Ferdinand Marcos Jr. Präsident der Philippinen. Das Regime des Vaters und dessen exzentrischer Frau Imelda, die Tausende Paar Schuhe shoppte und gern Wien besuchte, hatte über viele Jahre hinweg mit Mord, Kleptokratie und dem spurlosen Verschwindenlassen politischer Gegner von sich reden gemacht. Das Paar soll auch Milliardensummen aus der Staatskasse abgezweigt haben.
Kirgistans Bakijew in Belarus
Von einer Ex-Sowjetrepublik verschlug es Kurmanbek Bakijew in eine andere: Der kirgisische Präsident wollte per Verfassungsänderung noch mehr Macht an sich ziehen. Ein blutiger Volksaufstand jagte ihn 2010 schließlich aus dem aus dem Amt und dem Land. Sein autoritärer Amtskollege Alexander Lukaschenko gab ihm Asyl in Belarus - bis heute.
Von Liberia nach Nigeria und ins Gefängnis
Liberias Präsident Charles Taylor, einst Warlord im Bürgerkrieg, trat 2003 nach sechs Jahren nach Wiederaufflammen des Bürgerkrieges in dem westafrikanischen Land unter internationalem Druck ab und ging ins Exil nach Nigeria. Danach musste er sich als erstes Staatsoberhaupt Afrikas, vor einem internationalen Kriegsverbrechertribunal verantworten, dem Sondergericht für Sierra Leone. Er bewaffnete die Rebellen im Nachbarland und wurde mit sogenannten Blutdiamanten bezahlt, die unter unmenschlichsten Bedingungen geschürft wurden. 2012 wurde das Strafmaß auf 50 Jahre festgesetzt. Diese verbüßt er in Großbritannien.