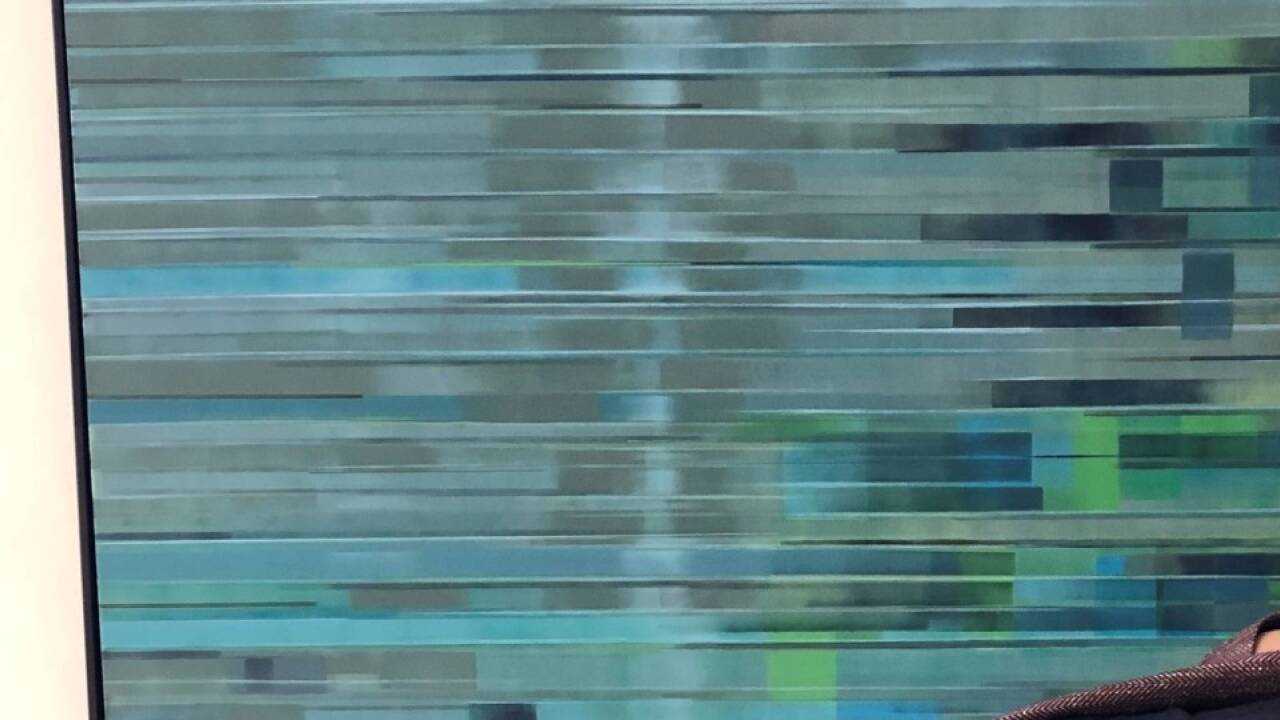Warum ist er traurig? "Ich sehe ein großes Verschwinden einer Kultur", sagt der Künstler Markus Schinwald. Mit sozialen Medien, digitalisierter Information und KI schwinde das Interesse für Geschichte sowie für Entwicklungen und Zusammenhänge. Immer mehr Menschen verharrten in einer Gegenwartsschleife. Das zeige sich auf sozialen Medien: Da tauche vieles auf und verschwinde sofort wieder: "Alles besteht aus Gegenwart." Kurzzeiterinnerung löse Langzeitgedächtnis ab. "Soziale Medien haben die Erinnerungskultur beeinträchtigt", sagt der Künstler im Gespräch über seine Gemälde in der Salzburger Galerie Ropac.
Wie sich das auf das Menschsein auswirkt, schildert er am Beispiel seines Metiers, der Kunst. Eine seiner Studierenden habe ihm ihre Bilder gezeigt - mit frappierender Ähnlichkeit zu Gemälden von Henri Matisse. Darauf angesprochen habe die Studentin erwidert: "Wer ist das?" Als er ihr Bilder von Matisse gezeigt habe, habe sie festgestellt: "Naja, da bin ich eh richtig gelegen."
Dass zwischen heute und Matisse 100 Jahre lägen, sei für die junge Generation kein Problem, schildert Markus Schinwald. "Die haben ein anderes Verständnis von Vergangenheit. Die tun, was die KI tut." Viele Künstler der jungen Generation operierten bloß mit Formen, Farben und Formaten, wüssten aber nicht mehr, was sie zitierten und was damit gemeint gewesen sei.
Dieser Art von Wahrnehmung und Produktion mangelt es an Geschichts- und Zukunftsverständnis sowie an den Fähigkeiten zu Interpretation und Inspiration. Für eine von KI erstellte Musik "gibt es keinen Interpretationsbedarf, denn es hat null Intention gegeben", sagt Markus Schinwald. Eine Analyse, welche Musikformen die KI verwendet habe, sei "ein Puzzlespiel, aber keine Interpretation". Er stellt fest: "Ohne Geschichtsbewusstsein gibt es keine Interpretation."
Die neuen Gemälde in der Galerie Ropac sind Markus Schinwald zufolge "Bilder der Trauer, des kontextuellen Verlusts". Und sie seien ein "Gegenprogramm" zu dieser in digitalen Kanälen gezüchteten Erinnerung, "die genauso kurz wie schnell ist". Er hat sie langsam gemalt: neun in dreieinhalb Jahren. Und er hat einen gloriosen Dreh gefunden, um den Kontrast vom analogen, erzählerischen Einst zum Jetzt auszudrücken: Auf Auktionen oder in Antiquariaten hat er kleine Gemälde des 18. oder des 19. Jahrhunderts erworben und deren Milieu - Farben, Malweise, Stimmung - fragmentarisch, aber inhaltlos ausgemalt. Die alten Bilder sind in die neue Umgebung eingeklebt und eingemalt.
Da stehen etwa drei Musikanten an einer Hauswand; sie wirken mickrig neben den geometrisierten Häusern und üppigen Goldwolken, die Markus Schinwald um sie herum komponiert hat. Oder eine schlafende Frau: Über sie lässt er amorphe Farbschwaden wuchern.
Ein zweiter Aspekt der Schau sind gewebte Bilder. Auch da verschränkt er Motive und Produktionsweisen von Einst und Jetzt. Warum Weben? Der mit Lochkarten programmierbare Jacquard-Webstuhl, Vorläufer des Computers, habe die industrielle Revolution eingeleitet, sagt Markus Schinwald. Dem ähnele die KI: "Der Weber des 19. Jahrhunderts ist der Dolmetscher unserer Gegenwart." Diesen und andere Berufe werde es in fünf Jahren nicht mehr geben.
Ausstellung: Markus Schinwald, "Interiors Inc.", Galerie Ropac, Salzburg, bis 23. Dezember.