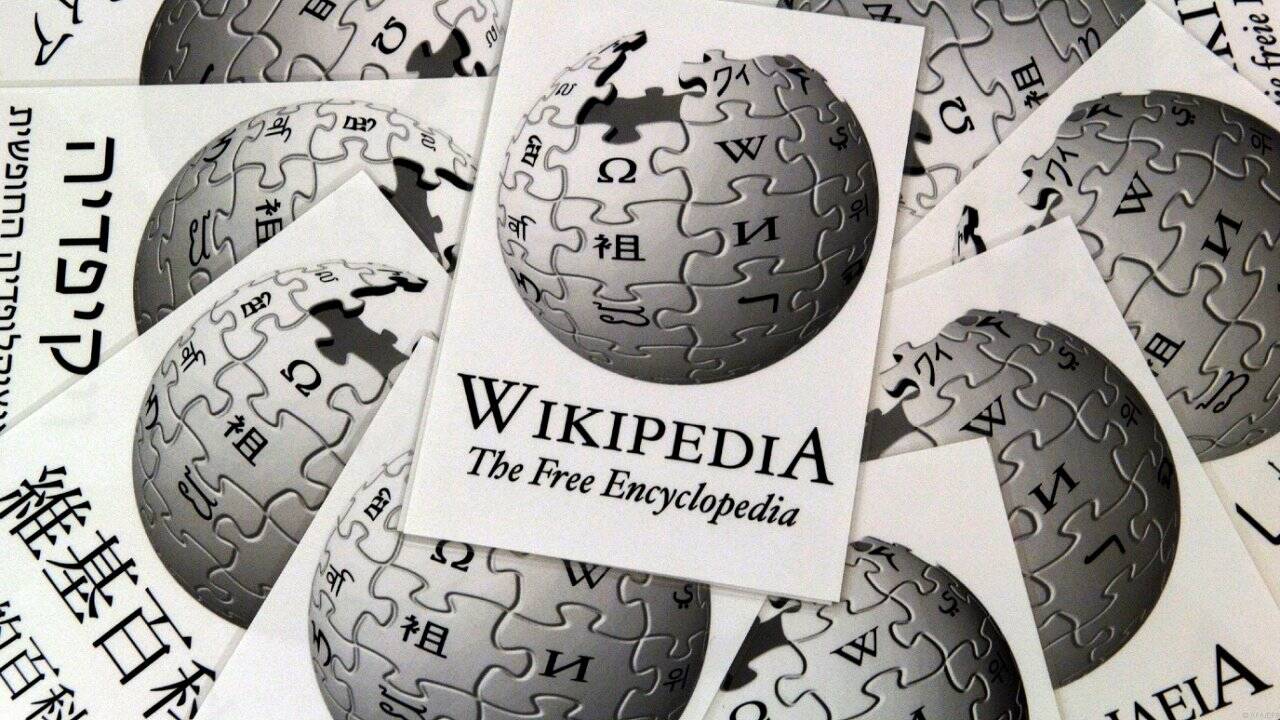"Hast du schon gehört?", fragt ein politisch interessierter Freund den anderen. "China arbeitet an Waffen zur chemischen Kriegsführung. Die werden in der Stadt Songo entwickelt, in einer Militäreinrichtung." "Wirklich? Wo hast du die Info her?" "Von Wikipedia. Steht da schon länger." "Ja, dann muss es stimmen." So ähnlich ist mit Sicherheit über Jahre hinweg das eine oder andere Stammtischgespräch gelaufen. Das Problem dabei: Weder die Militäreinrichtung noch die Stadt Songo gibt es. Beides wurde frei erfunden - und war dennoch rund sechs Jahre lang auf Wikipedia zu lesen.
Morgen, Freitag, feiert das weltgrößte Online-Lexikon Geburtstag. Seit 15 Jahren laufen die Server von Wikipedia. Doch in diesen eineinhalb Jahrzehnten hat das digitale Nachschlagewerk mehr aufgebaut als eine bloße Datenbank. Wikipedia hat die Art geändert, wie wir nach Wissen suchen. Und somit auch Wirtschaft, Bildung oder die Medienlandschaft beeinflusst.Von einem Kleinprojekt zur WissensmachtAm 15. Jänner 2001 gründeten die Amerikaner Jimmy Wales und Larry Sanger das Lexikon. Die Vision lautete damals wie heute: Das gesammelte Wissen der Menschheit sollte jedem frei zugänglich gemacht werden. Dazu sollte vor allem die Wikipedia-Software beitragen, ein frei verfügbares System, mit dem jeder Nutzer einfach Websites anlegen und bearbeiten kann. Und das Konzept ging auf: Einen Monat nach dem Start standen bereits 600 von Freiwilligen verfasste Artikel auf Wikipedia. Mittlerweile sind es 37 Millionen, übersetzt in 300 Sprachen. Auch die finanzielle Zuwendung kann sich sehen lassen: Wikipedia finanziert sich primär über Spenden. Bei der jüngsten Spendenaktion Ende 2015 wurden allein in Deutschland 8,6 Millionen gesammelt. Das Gesamtvermögen der Wikimedia Foundation, jener Organisation, die hinter Wikipedia steht, wird auf rund 78 Millionen Dollar (72 Millionen Euro) taxiert.Die Opfer von WikipediaDiese Erfolgsgeschichte hat aber nicht nur positive Folgen. Eines der "Opfer" von Wikipedia sind gedruckte Lexika. Bereits 2012 gab die Encyclopædia Britannica bekannt, dass das Lexikon nur noch digital erscheint - nach 244 Jahren. Zwei Jahre später zog der Brockhaus nach. Doch daran hat sich bis heute noch längst nicht jeder gewöhnt: "Es gibt immer noch viele Leute, die ein gedrucktes Lexikon haben wollen. Aber es gibt schlichtweg keines mehr", sagt etwa Roswitha Fuchs, Fachbuch-Verantwortliche bei der Salzburger Buchhandlung Höllrigl. "Ich kann dann nur auf das Internet verweisen. Doch das ist manchen gar nicht recht."
Auch an den Wikipedia-Mitarbeitern gehen solche Entwicklungen nicht spurlos vorüber. "Die meisten Wikipedianer sind keine reinen Computer-Nerds, sondern sehr Buch-affin. Von uns will niemand, dass es irgendwann keine Bücher mehr gibt", sagt Claudia Garád. Die gebürtige Deutsche ist Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, dem österreichischen Ableger der Wikimedia Foundation. Drei Mitarbeiter arbeiten von Wien aus hauptberuflich für die Foundation. "Dass Wikipedia so stark geworden ist, liegt mit Sicherheit ebenso daran, dass die Lexika-Verlage den digitalen Trend verschlafen haben", ergänzt Garád.Der Kampf gegen die VorurteileDoch ist es nicht bedenklich, dass jenes Wissen, das Millionen beeinflusst, von jedem nach Lust und Laune verfälscht werden kann? "Das stimmt so schon mal nicht", erläutert Garád. "Sie können auf Wikipedia nicht einfach Kopieren und Einfügen. Sie müssen Quellen nennen und Autoren angeben." Zudem könne entgegen der gängigen Meinung nicht jeder auf Wikipedia Artikel umschreiben: "Sie können einen Artikel freilich bearbeiten. Aber damit die Änderung angezeigt wird, muss sie von einem erfahrenen User freigegeben werden." Damit der sogenannten Sichterstatus erreicht wird, muss ein Wikipedia-Nutzer mindestens seit 30 Tagen registriert sein und 150 Artikel bearbeitet haben. Und die Sichter werden noch von Administratoren überwacht. Diese müssen sich für den (unbezahlten) Posten bewerben und werden schließlich von anderen Nutzern gewählt. Die Autorenzahlen sinkenDoch das hehre Wikipedia-Prinzip scheint zumindest nicht mehr ganz zu funktionieren. Während 2007 noch 51.000 Autoren an der englischen Version mitgeschrieben haben, waren es im November des vergangenen Jahres nur noch rund 30.000. "Der Pioniergeist der Anfangszeit ist verschwunden", beschreibt etwa Martin Haase. Der Romanistikprofessor an der Uni Bamberg hat mehrere Abhandlungen über Wikipedia verfasst. Der 53-Jährige vertraut Wikipedia dennoch: "Da meist viele Augen auf die Artikel schauen, gerade bei strittigen Fragen, kann man schon von einer hohen Verlässlichkeit ausgehen."
Und auch Claudia Garád glaubt an die Wiki-Welt. Doch die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich gibt sich durchaus kritisch: "Kein Inhalt ist völlig neutral - auch auf Wikipedia nicht. Man muss jede Information im Kontext sehen. Und bei jeder Recherche sollte man sein Gehirn einschalten."Das drittgrößte Regionalwiki kommt aus SalzburgEin Trend in der Wikipedia-Welt sind die Regionalwikis. Die regionalen Ableger sammeln jenes lokale Wissen, dass für die zentrale Wikipedia wohl zu speziell wäre.
Das größte Regionalwiki im deutschsprachigen Raum ist jenes zur Geschichte Wiens. Bereits auf Platz drei liegt das "Salzburgwiki". Der Salzburger Wikipedia-Ableger umfasst mehr als 23.500 Artikel sowie rund 29.000 Bilder, die von 4400 registrierten Nutzern gespeist werden.
Das Salzburgwiki wurde 2007 ins Leben gerufen, mit dem Ziel "das regionale Wissen zu stärken", wie Claus Meyer beschreibt. Der Wahl-Seekirchner ist Mitinitiator des Salzburgwikis. "Der Traum bleibt, die verschiedenen Institutionen, Archive und Gemeinden dazu zu animieren, ihr Wissen im Salzburgwiki zu teilen."
Mehr zum Thema: Leitartikel zu 15 Jahre Wikipedia - Wer unser Wissen macht