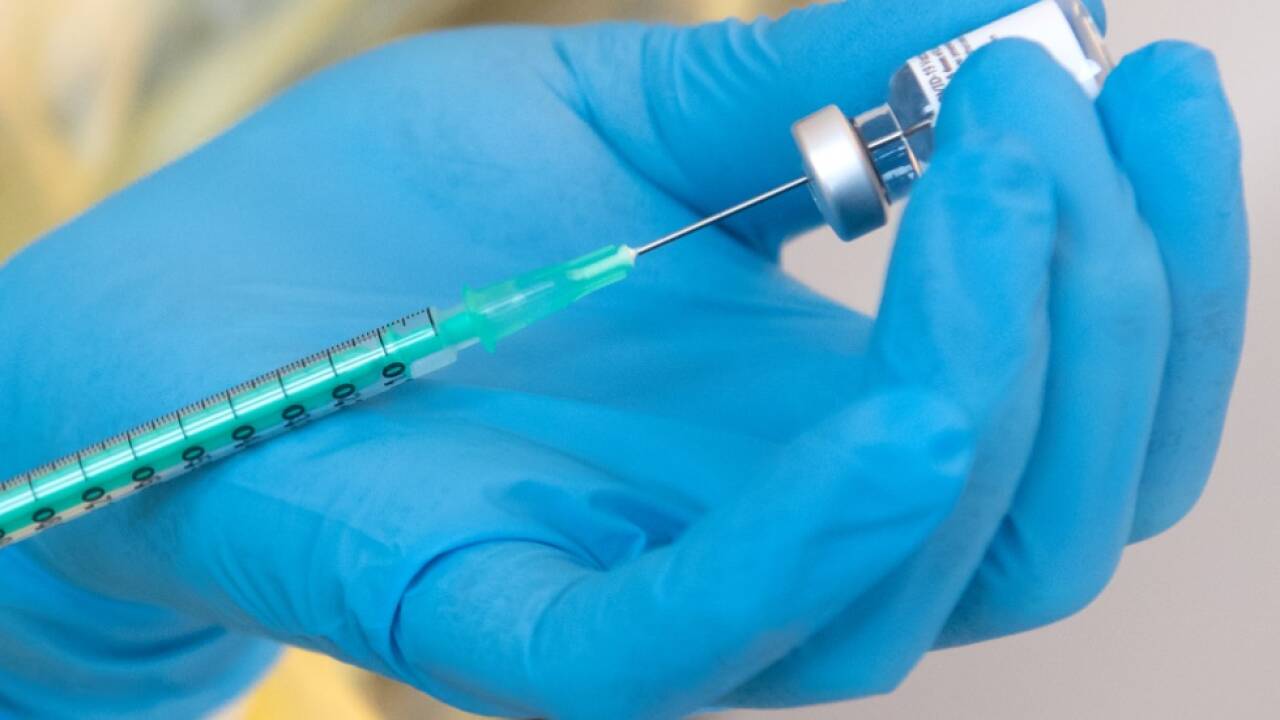Ursula Wiedermann-Schmidt ist Immunologin und Vakzinologin sowie Professorin an der Meduni Wien. Im SN-Interview erläutert sie, was wir von Corona für eine allfällige nächste Pandemie lernen können.
Vor fünf Jahren war Österreich im April gerade mittendrin im ersten Corona-Lockdown. Was ist damals in der ersten Phase der Pandemiebekämpfung medizinisch gesehen gut und was schlecht gelaufen? Ursula Wiedermann-Schmidt: In dieser ersten Phase hat uns - wie überall - das Virus völlig unvorbereitet erwischt. Alle waren schockiert von den Bildern der sterbenden Menschen aus Italien und die Angst war sehr groß, dass uns Ähnliches passieren könnte. In Österreich kam es daher relativ schnell zu Maßnahmen in Richtung Kontaktvermeidung bis hin zum Lockdown. Diese Maßnahme war wichtig und richtig, um zu verhindern, dass ähnliche Zustände wie in Italien passieren und das Gesundheitssystem überfordert ist. Dennoch waren die Spitäler - und speziell die Intensivstationen - sehr rasch gefüllt und das Spitalspersonal war einem unglaublichen Stress und Druck ausgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt konnte man noch gar nicht abschätzen, wie schlimm es werden kann, wen es treffen wird, wie man behandeln soll und kann, und von einer Impfung war noch lange keine Rede.
Was hat aus Ihrer Sicht damals nicht gut funktioniert? Und wann ist der Regierung das Ganze entglitten? Schwieriger ist es geworden, je länger Lockdowns gedauert haben oder sich wiederholt haben. Dazu gab es eine immer höhere Erwartungshaltung, dass endlich die ersten Impfstoffe kommen und die Pandemie beenden. Die waren noch bis Ende des Jahres 2020 (die ersten Impfungen in Österreich wurden am 27. Dezember 2020 verabreicht, Anm.) die Hoffnungsträger Nummer eins. Die Euphorie rund um die Impfung war anfänglich sehr groß, aber auch die Verunsicherung und das Bedürfnis nach Aufklärung waren sehr hoch, denn es handelte sich um eine neue Kategorie von Impfstoffen. Da anfangs nicht genügend Vakzindosen für alle vorhanden waren, mussten die Impfungen nach Risikogruppen gestaffelt durchgeführt werden. Übrigens war es schon eine logistische Leistung, überall in Österreich Impfstraßen einzurichten und diese auch mit genügend Personal zu bespielen. Unmut und Verunsicherung machten sich langsam breit, weil einerseits der Eindruck bestand, es werde nicht schnell genug geimpft, gleichzeitig musste man erkennen, dass sich das Virus offenbar ständig veränderte und neue Infektionswellen verursachte. Dazu kam eine Kommunikationsstrategie seitens Politik und auch der Medien, die widersprüchliche Aussagen förderte - das führte nicht zur Beruhigung der Bevölkerung. Man muss aber bedenken, dass die Situation für alle unbekannt war und man vieles nicht wissen konnte. Ich denke, man hätte öfters Mut zur Lücke haben und zugeben müssen, dass nicht alles über ein völlig neues Virus bekannt war und wir in einem kontinuierlichen Lernprozess steckten.
Gab es für Sie als medizinische Expertin einen speziellen Kipppunkt, wo Sie gemerkt haben: Jetzt verlieren wir den Draht zu den Menschen? Die Stimmung begann zu kippen, als trotz Impfungen Infektionen stattfanden und neue Virusvarianten zu weiteren Wellen führten. Ein wichtiger Punkt war, dass wir nicht gut genug erklärt haben, was man von der Impfung erwarten kann und was nicht. Heute wissen wir ganz genau, dass die Impfung vor allem vor schweren Erkrankungen, Hospitalisierung und Tod schützen kann. Jedoch war der Schutz vor Infektion und vor allem vor Ansteckung und Transmission sehr gering. Das führte zunehmend zu einem Vertrauensverlust und schwindendem Willen, sich impfen zu lassen. Die Stimmung kippte, als die Möglichkeit in den Raum gestellt worden ist, dass es in Österreich zu einer Covid-Impfpflicht kommen könnte. Dies war wahrscheinlich der erneuten starken Infektionswelle geschuldet, aber sicher seitens der Politik - befeuert durch diverse Medien - nicht der richtige Weg, zumal diese Regelung ohnehin zu spät gekommen wäre, denn das Virus wurde zwar infektiöser, aber nicht unbedingt gefährlicher.
Wie sah dieser falsche Weg der Politik konkret aus? Das Thema Impfen wurde und wird zunehmend durch die Politik missbraucht. Wenn Sie sich anschauen, was allein von einer Partei, der FPÖ, verbreitet wurde: Es seien nur die Geimpften, die in die Spitäler kämen und dort sterben würden, hieß es da. Oder dass sie Wurmmittel zur Behandlung von Covid anrieten. Und alle, die sich einsetzten, damit Impfungen durchgeführt werden können, wurden verteufelt und als korrupt bezeichnet. Da wurde massiv daran gearbeitet, die Bevölkerung falsch zu informieren und aufzuwiegeln. Aus anfänglichen Ängsten, denen man mit richtiger Aufklärung begegnen hätte sollen, wurden Aggressionen geschürt; das setzte sich dann fort. Das Schlimme ist, dass dieser Schaden bleibt und das Thema Impfen zunehmend kontrovers diskutiert wird. Als Folge fallen die Impfraten auch bei anderen Impfungen zunehmend ab, obwohl es sich um eine der wichtigsten und effektivsten Präventionsmaßnahmen in der Medizin handelt.
Extrem stark polarisiert hat die für kurze Zeit geltende Impfpflicht, die bald wieder aufgehoben wurde. Wie beurteilen Sie diese im Nachhinein? Die Impfpflicht war eine politische Entscheidung (die beim Landeshauptleute-Gipfel am 19. November 2021 am Achensee in Tirol verkündet wurde, Anm.), weil es damals zu einer erneuten Coronawelle gekommen war, die sehr intensiv war, und man eine rasche Gegenmaßnahme suchte. Seitens des nationalen Impfgremiums (NIG, Anm.) wurde das sehr kritisch gesehen, da bekannt war, dass Impfzwang immer auch mit extremer Ablehnung verbunden ist. Es wurde daher angeraten, dass nur mit intensiver Aufklärung ein solcher Schritt durchgeführt werden darf. Bekanntlich kam es nie zur Umsetzung, aber der Schaden, der zu einer Spaltung in der Gesellschaft und zu einer Abkehr vieler Leute vom System führte, war sehr groß.
Zurück zum Frühjahr 2021: Damals wurde erstmals das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken eingeführt; später wurden dann die FFP2-Masken Standard. War das medizinisch gesehen eine nachhaltige Maßnahme, die Sie jederzeit wieder empfehlen würden? Ich denke schon, denn das hat sich auch gezeigt. Es war ja auch ein Mittel, das schon bei früheren Pandemien immer eingesetzt wurde: Wenn man etwa die Bilder aus der Zeit der Spanischen Grippe 1918 betrachtet, dann werden Sie überall Leute sehen, die einen Mundschutz tragen. Denn eine Maske ist eine einfache Möglichkeit, die weitere Übertragung abmildern zu können und sich selbst vor Ansteckung zu schützen. Es ist eine der wichtigsten nicht pharmakologischen Maßnahmen in dieser Pandemie gewesen. Man hatte natürlich während der Pandemie noch keine Studien, die den Effekt gezeigt haben; daher gab es auch Kritik an den Masken. Aber mittlerweile gibt es mehr als 400 Studien, in denen man analysiert hat, wie hoch der Nutzen der Masken war. Klar ist natürlich, dass die Qualität der Masken eine Rolle spielt. Denn ein einfacher Mund-Nasen-Schutz hat natürlich weniger Effekt als FFP2-Masken - und natürlich muss man sie auch richtig tragen.
Vergleichsweise mehr Todesfälle als in der ersten Welle gab es dann in späteren Phasen im Winter 2020/21 bzw. Frühjahr 2021, als deutlich ansteckendere bzw. für das Immunsystem gefährlichere Virus-Mutationen auftauchten. War das nicht absehbar? Haben Politik und Gesundheitssystem hier immer richtig reagiert? Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber: Was sich gezeigt hat, ist, dass das SARS-CoV-2-Virus im Vergleich zu anderen Viren eine Ausnahme in puncto Mutationsfreudigkeit darstellt. Es war überhaupt nicht vorhersehbar, wie dieses Virus mutiert, und zwar in eine entweder noch gefährlichere Variante oder in eine, die besonders infektiös ist. Das sind Punkte, die auch die Virologen erstaunt haben, weil es bei anderen RNA-Viren in dieser Form bisher nie vorgekommen ist. Das Ganze war ein Prozess, bei dem wir alle jeden Tag dazugelernt haben. Aber in der Situation zu sagen, man hätte es besser machen können, halte ich auch heute noch für sehr schwierig, weil man es ganz einfach nicht besser gewusst hat. Die Wissenschaft lebt davon, zu analysieren und zu lernen, um neue Zusammenhänge und Gegebenheiten zu verstehen. Gerade im Impfsektor und in der Immunologie haben wir unglaublich viel gelernt. Wir konnten analysieren, wie das Immunsystem auf einen neuen Erreger in verschiedenen Altersgruppen, bei verschiedenen Gesundheitszuständen reagiert, wie lange der Schutz hält und wer wann aufgefrischt werden muss. Daraus konnten wir neue Erkenntnisse gewinnen, die man in einer ähnlichen Situation mit einem anderen Erreger anwenden wird können.
Das heimische Spitalssystem, und hier speziell die Kapazitäten auf den Intensivstationen, kamen punktuell teils ans Limit. Was lässt sich daraus für eine allfällige nächste Pandemie lernen? Brauchen wir mehr Intensivbetten? Oder müssen wir die Erkrankten nur besser verteilen? Ich bin weder Intensivmedizinerin noch Gesundheitsökonomin. Aber ich glaube kaum, dass es möglich ist, die Anzahl an Intensivbetten permanent zu erhöhen, weil das sehr teure Einrichtungen sind, die unter normalen Bedingungen weder ausgelastet noch bespielbar wären. Daher musste man durch die Lockdowns gegensteuern, um so die Infektionswellen zu bremsen und eine Überfüllung der Spitäler und Intensivstationen zu verhindern. Was außerdem stattgefunden hat, waren Kooperationen verschiedener Spitäler im In- und Ausland, damit Menschen in unterschiedlichen Spitälern versorgt werden konnten.
Umstritten waren auch die teils monatelangen Schließungen der Schulen - die, wie wir heute wissen, viele Kinder und Eltern stark psychisch belastet haben. Mit dem Abstand von fünf Jahren: Würden Sie der Politik heute wieder zu so einem Schritt raten? Das ist vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann: Im Nachhinein hätte man die Schulschließungen frühzeitiger reduzieren können. Am Anfang waren sie notwendig, weil sich die Infektionsketten über alle, auch die Kinder, ausgebreitet haben. Aber sobald die Vakzine am Markt waren und die Menschen zunehmend geimpft werden konnten - Lehrer, Eltern wie auch die Kinder -, hätte man bei den Schulschließungen etwas ändern können. Was sich jedenfalls gezeigt hat, war, dass die Kinder in der Regel nicht schwer erkrankten und auch nicht die Infektionstreiber waren.
Das heißt, dieses geflügelte Wort, dass Kinder sogenannte Superspreader seien, hat eigentlich nicht gestimmt? Bei Influenza ist das schon zutreffend. Aber bei Covid-19 dürfte das weniger der Fall gewesen sein. Natürlich kann man sich überlegen: Wären das Umfeld, also alle Erwachsenen im Haushalt, besser geimpft gewesen, dann hätten auch Kinder, die infiziert sind, die Infektionen nicht so leicht nach Hause bringen können. Aber ein Thema war auch der potenzielle Kontakt der Schulkinder zu den älteren Personen und die Angst, dass sie etwa ihre Großeltern anstecken und diese ein höheres Mortalitätsrisiko haben. Aber: Heute muss ich sagen, wenn man in andere, zum Beispiel die skandinavischen, Länder blickt, die ganz ohne Schulschließungen ausgekommen sind, dann ist das schon ein Punkt, den man wahrscheinlich besser machen hätte können und damit verbundene Probleme hätten vermieden werden können.
Sie sitzen neben dem heimischen nationalen Impfgremium NIG auch im deutschen Pendant namens Stiko. Hat Deutschland beim Thema Impfen besser agiert? Denn eine Impfpflicht gab es dort nie. Eine Impfpflicht wurde in Deutschland nicht diskutiert - genau aus diesen Gründen, weil Deutschland hier schon mit der Masernimpfpflicht entsprechende Erfahrungen gesammelt hatte. Aber ich muss sagen: Ich bin in den Expertengremien für Impfungen gesessen, die aber nie politische Entscheidungen getroffen haben. Sowohl in der Stiko als auch im nationalen Impfgremium haben sich die Fachleute mehrheitlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es auch in Deutschland genau dieselben Probleme rund ums Impfen gegeben hat wie in Österreich. Es gibt die gleichen politischen Strömungen wie in Österreich, die sehr forciert gegen Impfen und Impfzwang auftreten und über soziale Netzwerke Stimmung generell gegen Impfungen, aber auch gegen die Wissenschaft und die Experten machen.
Bei Coronamaßnahmen-Kritikern sehr umstritten sind - nicht nur in Deutschland - die sogenannten, erst 2024 bekannt gewordenen RKI-Files. Sie zeigen, dass hier der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen sehr viel strengeren Kurs gefahren ist, als der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) vorschlug - was Anlass für viele Verschwörungstheorien ist. Hat die deutsche Politik hier aus Ihrer Sicht zu streng agiert - und möglicherweise die Bevölkerung sogar belogen? Ich war und bin nicht involviert in diese Causa. Ich weiß auch nur aus den Medien, dass hier offenbar nur Teile bzw. Bruchstücke aus Protokollen des RKI weiterverwendet worden sind. Sie wurden aus dem Kontext gerissen und dann so präsentiert, als ob sie politische Sprengkraft hätten. Soviel ich weiß, ging es da um die Einschätzung, wie die Risikobewertung der Covidwellen zu sehen ist, beziehungsweise auch die Einschätzung hinsichtlich des Risikos der Erkrankung selbst. Es ging aber auch um die Frage, ob Lockdowns einen Schaden für die Gesellschaft anrichten. Mein Eindruck war immer, dass vonseiten des RKI alles im Sinne der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung versucht wurde.
Das heißt, das Ganze ist für Sie mehr ein Sturm im Wasserglas? Ja, wie es halt so läuft, wenn einzelne Aussagen verwendet werden und dann so gedreht werden, dass sie in Verschwörungstheorien passen. Das passiert ja leider ständig über diverse Social-Media-Kanäle.
In Österreich hat der damalige Gesundheitsminister Rudi Anschober gegenüber den SN eingeräumt, dass auch er Fehler gemacht hat. Gab es für Sie Punkte, wo Sie und Ihre ärztlichen Kollegen Fehler gemacht haben oder sich nicht gegen die Politik durchsetzen konnten? Es war ganz schwierig, während der Pandemie eine für Österreich einheitliche Linie zu fahren. Jedes Bundesland wollte einen eigenen Kurs fahren. Das ist für ein kleines Land wie Österreich schon besonderes, nämlich besonders abstrus. Der Föderalismus zeigt sich in vielen Situationen, nicht nur im Gesundheitswesen per se, sondern eben auch im Krisenmanagement. Die Aufgabe des nationalen Impfgremiums war es, im Bereich der Impfungen zu beraten, Entscheidungen konnten und können wir nicht treffen. Die medizinischen Überlegungen wurden dann von der Politik entweder angenommen oder nicht angenommen, wobei deren Entscheidungen sicher nicht nur von medizinischen Aspekten abhingen, sondern auch von anderen Aspekten, wie wirtschaftlichen Fragen.
… etwa gleich im März 2020, bei der Frage, ob man etwa das Skigebiet in Ischgl doch gleich nach den ersten Infektionen hätte schließen sollen? Ja, damals ging es generell um die Frage, ob es möglich ist, die Skilifte weiter offen zu halten. Diese Entscheidungen waren dann schließlich wohl rein politische Entscheidungen des Landes.
Fachleute wie der Virologe Florian Krammer sagen, dass die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit sei - und möglicherweise auch von einer anderen Zoonose ausgehen könnte, wie etwa der Vogelgrippe. Halten Sie das für realistisch? Da sollte man sich an den Rat der Virologen halten. Man sagt: "Nach der Pandemie ist vor einer Pandemie, nur der Zeitpunkt ist ungewiss." Ob das H5N1-Virus Auslöser sein wird oder ein anderes Influenza-ähnliches Virus oder ein völlig anderes Virus, ist aber wirklich sehr schwierig abzusehen. Wichtig ist, rechtzeitig die nötigen Managementstrategien zu haben. Aus diesem Grund wurde nun auch in Wien das interdisziplinäre Ignaz-Semmelweis-Institut für Infektionsforschung gegründet, das unter anderem der "preparedness" (angemessenen Vorbereitung, Anm.) für eine nächste Pandemie dienen soll.
Neu ist, dass sich die WHO nun auf weltweite Pandemie-Abkommen geeinigt hat. Was bringt das für Vorteile? Sehr wichtig ist eine weltweite Kooperation, Information und Vernetzung der globalen Daten, damit Informationsweitergabe über Infektionsereignisse so schnell wie möglich erfolgt und es dabei zu keinem Zeitverlust kommt. Ein wichtiger Punkt war ja in der Covidpandemie auch die weltweite Versorgung mit Impfstoffen. Es war ein großes Problem, dass alle Länder - besonders die ressourcenarmen Länder - mit Impfstoffen unterversorgt waren. Daher muss es ein Ziel sein, dass alle Länder mit Impfstoffen ausreichend ausgestattet werden können.
Sprich, es braucht mehr internationale Solidarität? Natürlich, aber wie man weiß, sind das oft schöne Worte. Denn die Frage ist, wenn es hart auf hart geht und wenig Mittel verfügbar sind - ob das Hemd oder die Hose näher ist? Daher ist es wichtig, in Zeiten ohne Krise Pläne zu erarbeiten, die auch im Notfall funktionieren, damit zum Beispiel gewährleistet werden kann, dass Versorgungen mit Medikamenten oder anderen Maßnahmen tatsächlich funktionieren.
Was wünschen Sie sich generell von der Politik, um unser Gesundheitssystem möglichst fit für eine allfällige neue Pandemie zu machen? Welche drei Punkte wären hier am wichtigsten? Ich denke, wir müssen an der Gesundheitsbildung in der Bevölkerung arbeiten, damit sowohl eine konstruktive Auseinandersetzung mit Gesundheitskrisen als auch solidarisches Handeln möglich sind. Das Thema Gesundheit muss schon möglichst frühzeitig in Kindergärten und Schulen vermittelt werden. Das zweite betrifft die Kommunikationsstrategien zu gesundheitspolitischen Themen: Damit meine ich Informationen und Kommunikationen, die auf verschiedene Altersgruppen abzielen, aber auch an die sozialen Medien angepasst werden. Hier müssen neue Informationstools eingesetzt werden, um auch junge Leute vermehrt für Gesundheitsthemen zu interessieren. Punkt drei ist: Mir kommt vor, dass die Wissenschaftsfeindlichkeit massiv zugenommen hat. Da wünsche ich mir ein klares Bekenntnis seitens der Politik, dass ohne Wissenschaft kein Fortschritt möglich ist. Ich denke, es gibt einen großen Unterschied in der Einstellung zur Wissenschaft in skandinavischen Ländern im Vergleich zu unseren Breiten. Das Thema Gesundheitsvorsorge wird von Kindesbeinen an trainiert und daher gab es auch während der Pandemie wenig Ablehnung gegen Impfungen oder Maßnahmen, die seitens der Wissenschaft vorgeschlagen wurden.
Um es auf den Punkt zu bringen: Hätte der selbstverantwortliche schwedische Weg der Pandemiebekämpfung angesichts der österreichischen Mentalität bei uns überhaupt funktionieren können? Nein, das denke ich nicht. Schweden hat eine andere Gesellschaftsstruktur und kulturelle Erziehung, die Leute haben ein anderes Verständnis von gesellschaftlichen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Einstellungen zu staatlichen Institutionen und Vorgaben. Wenn es da heißt: "Social Distancing während der Pandemie ist wichtig" - dann ist das größtenteils auch ohne Lockdowns akzeptiert worden. Dieses Grundvertrauen in Wissenschaft und Staat hat in Österreich, aber auch in anderen Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, zunehmend abgenommen. Diese Nachwehen der Pandemie werden uns noch lange begleiten, wobei eine Bringschuld zur Verbesserung wohl jeden von uns trifft.