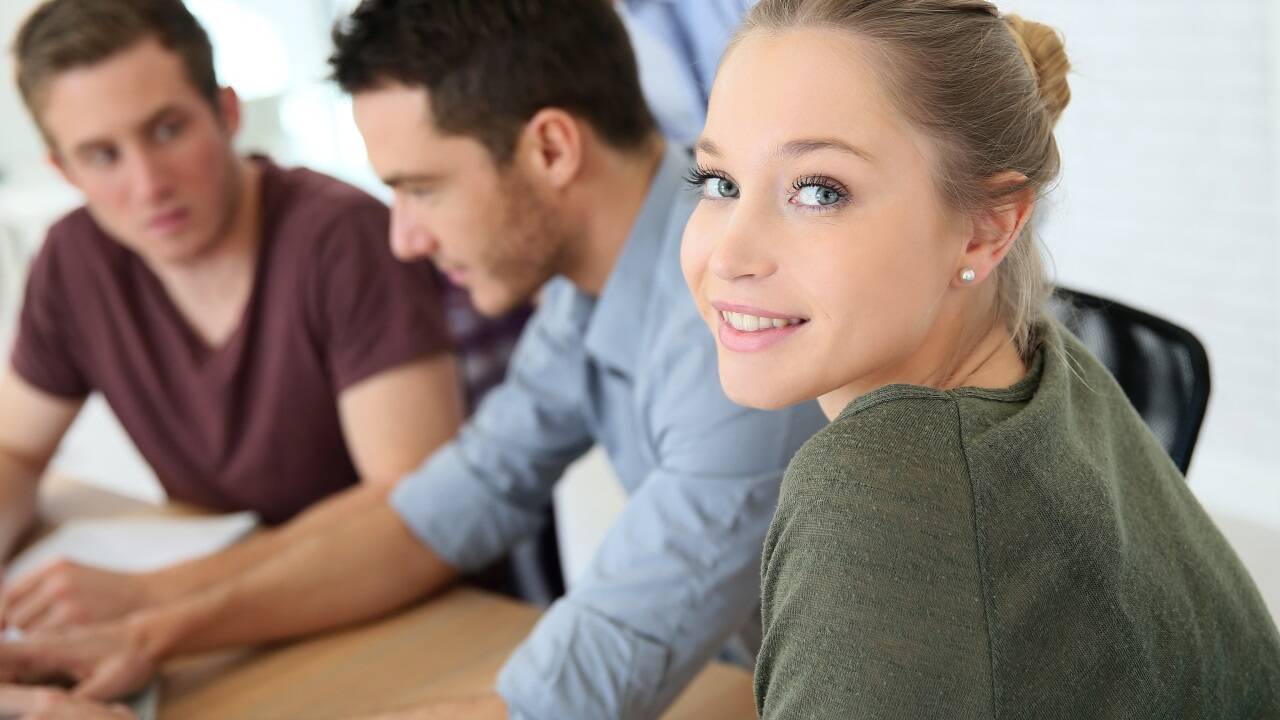91 Prozent wollen eine gute Ausbildung; 88 Prozent sorgsam mit der Umwelt umgehen. 87 Prozent möchten eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus besitzen. Weiters will ein Großteil eine feste Partnerschaft und genug Zeit für Freizeitaktivitäten.
Das sind einige der zentralen Ergebnisse jener Studie, für die die Arbeiterkammer (AK) Salzburg vom Meinungsforschungsinstitut Ifes 505 junge Salzburgerinnen und Salzburger zwischen 16 und 34 Jahren befragen ließ. So weit, so erwartbar, könnte man meinen.
Die meisten wünschen sich "bürgerliche Normalbiografie"
Sieht man sich die Erhebung, bei der im Frühjahr/Sommer 2023 zusätzlich vom Fachbereich Soziologie der Uni Salzburg qualitative Interviews mit 30 jungen Leuten (15 bis 29 Jahre) durchgeführt wurden, genauer an, erstaunen manche Fakten: So ist auch für Wolfgang Aschauer, Soziologieprofessor an der Uni Salzburg, "überraschend, dass sich die meisten Befragten ein Leben im Sinne einer ,bürgerlichen Normalbiografie' wünschen - obwohl es auch unterschiedliche Lebenswelten gibt". Denn die Gruppe der sogenannten "eigenmächtigen Individualisten" sei eindeutig in der Minderheit. Erklären kann er sich diese scheinbare Angepasstheit mit den diversen Krisen der vergangenen Jahre - von Corona über den Ukraine-Krieg und die Teuerung bis zur Klimakrise: "Dadurch haben viele eine Sehnsucht nach Harmonie entwickelt. Man versucht, als junger Mensch zwischen den verschiedenen Erwartungen zu jonglieren, um so den Weg in die Gesellschaft zu finden."
Weg von politischen Extremen
Als zweiten für ihn überraschenden Punkt nennt der Soziologe den klar erkennbaren Weg der Jungen "weg von politischen Extrempositionen". Dennoch gebe es auch ein starkes Bewusstsein für die Klimakrise sowie den Wunsch nach einer nachhaltigen, ökologischen sowie offenen und toleranten Gesellschaft, sagt er. Aschauers Dissertant Christoph Etter, der auch bei der Studie mitgearbeitet hat, betont, dass ihn vor allem die große Reflexionsfähigkeit der jungen Leute positiv gestimmt habe: "Obwohl die meisten Harmonie und soziale Beziehungen und kein Leben als Aussteiger haben wollen, wollen sie auch keine traditionellen Geschlechterrollen mehr leben. Also: Auch Frauen wollen Karriere machen und Männer sich dem Familienleben widmen."
Fehlende Rahmenbedingungen für gleich verteilte Kinderbetreuung
Hier hakt Martin Oppenauer von Ifes ein, der die quantitative Befragung durchgeführt hat und die Ergebnisse mit Aschauer am Mittwoch präsentiert hat. Oppenauer verweist darauf, dass die Fortschritte bei der Geschlechtergleichstellung von den Befragten sehr positiv bewertet wurden. "Aber wir sehen, dass die Aufteilung der Kinderbetreuung in der Praxis weiter eher traditionell läuft. Da lese ich heraus, dass es eher nicht am Willen scheitert, es liegt vielmehr an den fehlenden Rahmenbedingungen für eine zwischen Mann und Frau gleich verteilte Kinderbetreuung."
Genz Z will arbeiten, aber unter gewissen Bedingungen
Bestätigt die Studie aber nicht auch Vorurteile gegenüber der Generation Z, zu der die Jungen der Geburtsjahrgänge zwischen 1995 und 2010 gehören? Denn laut der Erhebung wollen 70 Prozent der jungen Salzburgerinnen und Salzburger weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten; das gewünschte Ausmaß beträgt 33 Stunden. Ist dieser Generation eine gute Work-Life-Balance also wichtiger als Karriere?
Karin Hagenauer, Leiterin des Referats Arbeitsbedingungen und ArbeitnehmerInnenschutz der AK Salzburg, verneint: "Das Klischee, dass die Generation Z nicht arbeiten will, stimmt nicht. Sie wollen arbeiten - aber nicht um jeden Preis, sondern daneben auch noch Zeit für die Familie und andere Dinge haben." So ist 92 Prozent der Befragten wichtig, dass Erwerbsarbeit und andere Lebensbereiche gut vereinbar sind. "Zudem wollen 79 Prozent eine sinnstiftende Arbeit", betont Hagenauer. Den Jungen sind aber auch gute Arbeitsbedingungen wichtig: Befristete Verträge und lange Arbeitswege sind für drei Viertel von ihnen ein Grund, einen Job nicht anzunehmen. Weiters wollen 50 Prozent keine unregelmäßigen Arbeitszeiten. Hagenauer: "Außerdem lehnen 45 Prozent eine ständige Erreichbarkeit ab. Ebenfalls 45 Prozent der jungen Väter sagen, sie wollen mehr Zeit für die unbezahlte Familienarbeit haben."
Viele Sorgen und Krisen belasten junge Leute
Ifes-Forscher Oppenauer betont, dass ihn nicht überrasche, dass das Stresslevel unter den Befragten sehr hoch sei, und "die Krisen der Zeit eine enorme Belastung für sie darstellen und sich das stark auf den Ausblick in die Zukunft auswirkt - der dann eher pessimistisch ausfällt".
Dazu noch zwei Zahlen: 88 Prozent der Befragten machen sich Sorgen um erschwingliches Wohnen und die Teuerung, speziell beim Thema Wohneigentum. Dessen Erwerb wird als praktisch unmöglich betrachtet. Jede zweite befragte junge Familie ist mit dem Angebot an Kinderbetreuung unzufrieden: Was die Leistbarkeit von Krabbelstube, Kindergarten & Co. betrifft, sind es 75 Prozent, die sich durch diese Kosten finanziell belastet fühlen; 44 Prozent sehen sich sehr stark belastet.
Bei der Frage, wie Arbeitgeber und Politik hier gegensteuern könnten, um etwa die Generation Z doch zu Vollzeitjobs motivieren zu können, nennen die Fachleute mehrere Punkte. Soziologe Aschauer verweist auf die in der Studie genannten Vorschläge der Befragten: etwa den Ausbau von Homeoffice-Optionen, mehr Weiterbildung, bessere Kinderbetreuungsangebote sowie eine faire Entlohnung und die Selbstgestaltung der Arbeit.
Auch Junge haben Angst vor fortschreitenden Digitalisierung
AK-Expertin Hagenauer sieht es als "gesamtgesellschaftliches Ziel, dass die Wochenarbeitszeit sinken muss. Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Weniger zu arbeiten darf nicht nur eine Sache für die besserverdienende Elite sein."
Weil in der Umfrage selbst von einem Teil der Jungen eine gewisse Angst vor der fortschreitenden Digitalisierung genannt wurde, sieht Hagenauer auch das Schulsystem gefordert: "Ihnen nur ein Tablet in die Hand zu drücken und ein Fach ,Digitale Grundbildung' einzuführen ist zu wenig." Gefragt sei mehr Reflexion über die Inhalte der digitalen Welt, sagt sie. Oppenauer betont, die Jugend von heute sei trotz Pessimismus durchaus politisch: "Sie haben hohe Erwartungen an die Politik - etwa bei den Maßnahmen gegen die Teuerung. Und ihnen sind ein gutes Bildungs- und ein kostenloses Gesundheitssystem wichtig. Sie wären schon von der Politik abholbar, wenn sich diese um die gewünschten Anliegen auch kümmern würde."