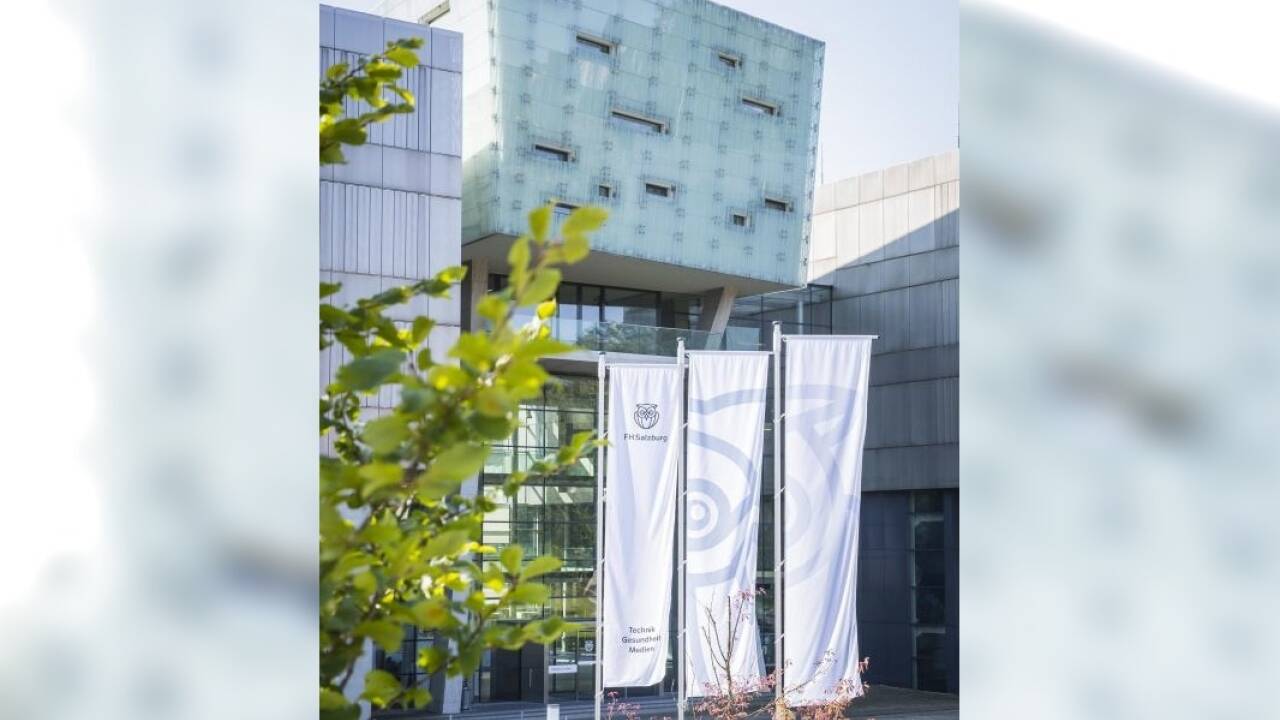Im Herbst 1994 wurden die ersten Fachhochschulen in Österreich gegründet; jene in Salzburg folgte 1995. Wie sich der Sektor seither entwickelt hat, erzählt Raimund Ribitsch (60): Er war von 2000 bis 2022 Geschäftsführer der FH Salzburg (kurz: FHS) und hat 2005 den Umzug vom Techno-Z in Salzburg-Itzling nach Puch-Urstein verantwortet. Aktuell fungiert der Betriebswirt dort als Prokurist. Von 2017 bis 2021 war er Vorsitzender der FH-Konferenz, in der alle Geschäftsführungen, Kollegiumsvorsitzenden und Studiengangsleiter der österreichweit 21 Fachhochschulen vertreten sind.
Wie schwierig war es, dass es 1994/95 zur Gründung der FH Salzburg kam? Raimund Ribitsch: Wie mir berichtet wurde, waren die Aufbruchsstimmung und die Bereitschaft für etwas Neues damals sehr groß. Der erste Studiengang war Telekommunikationstechnik & Systemmanagement; parallel haben Holztechnik und Holzwirtschaft in Kuchl begonnen. Für beide Richtungen gab es großen Bedarf der regionalen Wirtschaft. Die Unterstützung des Landes war von Anfang an groß und man hat der FH hohes Vorschussvertrauen gegeben. Das Land hat, zusätzlich zum Bund, die Studiengänge sehr großzügig kofinanziert und sie als wichtige Ergänzung zur Uni Salzburg gesehen.
Wer war damals Träger der FH Salzburg? Das war der sogenannte Techno-Z-Förderverein. Mitglieder waren Land und Stadt Salzburg, Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie ein Konsortium von vier Banken. Weiters gab es einen eigenen Trägerverein für das Holztechnikum Kuchl. Von 2001 bis 2003 gab es noch einen weiteren Trägerverein der AK, weil deren Tochterfirma den Studiengang Soziale Arbeit betrieben hat. 2003 wurden zunächst die Studiengänge in Kuchl in die neu gegründete FH Salzburg GmbH übernommen. 2005 hat die Wirtschaftskammer die Hälfte ihrer Anteile an der FHS GmbH an die AK übertragen; und diese hat dafür die Sozial-Studiengänge eingebracht. Wir waren in Salzburg österreichweit die Einzigen, die am Ende drei Trägervereine in eine landesweite FH-Gesellschaft fusioniert haben. Denn wir haben die vom Bund geforderte Konsolidierung der FH-Standorte und der FH-Träger sehr ernst genommen.
Es gab immer wieder die Kritik, dass mit mittlerweile 72 FH-Standorten, verteilt auf 32 Städte, ein Wildwuchs passiert sei, weil teils jede größere Bezirkshauptstadt eine FH wollte. Waren hier die Erwartungen zu optimistisch? Müssen bzw. sollten sich einige FHs gesundschrumpfen? So wie ich jetzt den FH-Sektor überblicke, geht es nicht ums Gesundschrumpfen, sondern ums maßvolle Weiterwachsen, speziell im Gesundheitsbereich. Denn das macht Sinn und ist notwendig, weil es da auch großen Personalbedarf gibt. Und: Mehrere regionale Standorte eines Träger sind in Flächenbundesländern meines Erachtens durchaus vertretbar. Aber man muss schon sagen, dass Standorte außerhalb von städtischen Zentren durchaus auch Herausforderungen haben.
Gibt es von der Organisation her nicht so etwas wie eine kritische Mindestgröße bzw. ein Minimum an Angebot und Infrastruktur, die ein FH-Standort haben sollte? Da traue ich mir keine allgemeingültige Antwort zu geben. Fix ist: Es sollten einige Hundert Studierende sein; und es sollte eine ordentliche öffentliche Verkehrsanbindung geben. Bezüglich Wohnmöglichkeiten hängt es davon ab, ob es Vollzeit- oder berufsbegleitende Studiengänge sind. Letztere haben nämlich im regionalen Umfeld von 100 Kilometern absolut Sinn und sind auch langfristig erfolgreich. Gerade wenn man sich etwa Kuchl ansieht, das es seit 1995 als FH-Standort gibt: Wir hatten dort die ersten zehn Jahre kein Studierendenheim, der Standort hat aber trotzdem funktioniert. Ein großer Wettbewerbsvorteil ist aber in jedem Fall die unmittelbare Nähe zu Unternehmen, die mit einer FH kooperieren wollen. Denn die 21 Fachhochschulträger haben aktuell einen Forschungsumsatz von nicht weniger als 165 Millionen Euro im Jahr. Das geht nur mit guten Partnern - und wenn man gut und relevant ist für die regionale Wirtschaft. Diese Relevanz für die Wirtschaft ist die Daseinsberechtigung für die heimischen Fachhochschulen.
Wie ist es ausgerechnet Salzburg gelungen, bald nach der Gründung den Urheber des FH-Gesetzes, Ex-Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP), als Rektor zu gewinnen? Und was hat er hier bewirkt? Erhard Busek war definitiv ein Jackpot für uns. Ich habe schon 2005 anlässlich der neuen Trägerschaft von AK und WK gesagt: "It's all about people." Denn es geht darum, Menschen zusammenzubringen und Gelegenheiten zu nutzen. Die Gelegenheit damals war, dass unser Gründervater Wolfgang Gmachl, der langjährige Direktor der WK in Salzburg, Busek sehr gut kannte: Sie waren sehr eng und lange Jahre politische Weggefährten. Was Busek bei uns bewirkt hat, war, den großen europäischen Geist hereinzubringen. Denn er war parallel auch Präsident des Europäischen Forums Alpbach und das war auch für uns eine gute Gelegenheit, mit Forschungsprojekten in Alpbach aufzutreten. Was Busek geschafft hat, war, Menschen als Vortragende an die FH zu bringen, die sonst nie gekommen wären. So haben wir damals diverse Symposien abgehalten; das hat uns insgesamt den Blick über den regionalen Tellerrand hinaus ermöglicht.
Anlässlich des Jubiläums 30 Jahre FH in Österreich wird in vielen Festreden von einem Erfolgsmodell gesprochen. Ist das uneingeschränkt berechtigt? Definitiv - und zwar vor dem Hintergrund, was es 1994 in Österreich geben hat: Da gab es etwa 20 öffentliche Unis - und sonst nichts im tertiären Sektor: Keine einzige Privatuni und auch noch keine Pädagogischen Hochschulen. Die FHs wurden gegründet, weil sie von der EU-Kommission dringend zur Hebung der Akademikerquote und der Wettbewerbsfähigkeit und für die Ankurbelung der Forschungs- und Innovationstätigkeit der heimischen Wirtschaft empfohlen wurden. Und die Zahlen geben uns recht: Die FHs haben seither rund 240.000 Absolventen produziert, bei knapp 65.000 Studierenden pro Jahr. 1500 Forschende bewältigen an den 21 Fachhochschulen ein Forschungsvolumen von 165 Mill. Euro pro Jahr. Auch die Zahlen zur sozialen Durchlässigkeit zeigen, dass die FHs hier führend sind: Denn wir bieten berufsbegleitende Studien an und versprechen den Studierenden, dass sie in der Regelstudienzeit fertig werden und damit die finanziellen Belastungen für sie und ihre Angehörigen planbar sind. Und noch zur tollen Initiative von Emmanuel Macron, der Schaffung von europäischen Universitäten: Da muss man sagen, dass die FHs in Österreich gut dabei sind, auch international.
Apropos soziale Durchlässigkeit: Hat es den FHs nicht geschadet, dass ihre Studierenden die 363 Euro pro Semester an Studiengebühren zahlen müssen, die Studis an den Unis aber, wenn sie in der Regelstudienzeit bleiben, davon befreit wurden? Nein, weil die Studis wissen, was sie bei uns bekommen: Das ist die unmittelbare Betreuungsleistung, persönlich in Form von kleineren Gruppengrößen, und ein quantitativ besseres Verhältnis von Lehrenden pro Studierendem. Zudem finden unsere Studierenden tolle Gebäude und eine hochattraktive Ausstattung vor.
Andererseits gab es bei diesem Baby wohl auch viele Geburtswehen und Kinderkrankheiten, oder? Eine Herausforderung war sicher in den ersten 15 Jahren die geringere Bekanntheit der Fachhochschulen im Vergleich zu den Unis. Und die Vorbehalte, ob denn die Ausbildung an den FHs gut sei. Ein Geburtsnachteil ist die strenge Pro-Kopf-Studienplatzfinanzierung, auch, weil sie nicht automatisch valorisiert wird und weil die finanzielle und inhaltliche Umschichtung von einem Studienplatz in einen anderen Studiengang ein mehrstufiges Behördenverfahren auslöst. Eine Herausforderung war sicher die Unbekanntheit, dass eine Hochschule in Form einer GmbH betrieben wird. Das führte einfach zu Unklarheiten, weil man das in Österreich nicht gewohnt war; aber das hat sich mittlerweile definitiv gebessert. Und: Die akademische Selbstverwaltung durch das FH-Kollegium musste erst gelernt werden. Aber über die 30 Jahre hinweg gesehen funktioniert das jetzt und man ist zu verteilten Rollen und einem guten Miteinander gekommen.
Gerade an der FHS gab es aber jahrelange Machtkämpfe zwischen dem für die akademischen Belange zuständigen Rektorat und der für das Kaufmännische zuständigen Geschäftsführung. Erst seit dem Vorjahr sind hier beide Führungsebenen in Person von Rektor und Geschäftsführer Dominik Engel in einer Hand. Warum ist das nicht schon früher passiert? Die seinerzeitige Führungsstruktur hat funktioniert! Wir sind erfolgreich gewachsen, haben neue Standorte realisiert, eine tolle Forschung aufgebaut, haben als eine der ersten Fachhochschulen den Gesundheitsbereich integriert und die heutige Bedeutung erlangt. Und zur Frage der Leitungszusammenlegung in eine Hand: An den Fachhochschulen gibt es unterschiedliche erfolgreiche Modelle, wobei das Modell "Rektorat und Geschäftsführung in einer Hand" bei einer Minderheit der FHs der Fall ist. Primär geht es um eine gute Rollenverteilung - konkret um die Wahrnehmung der jeweiligen Verantwortung. Das hängt immer davon ab, ob die beteiligten Personen das auch so wollen. Und unsere Träger haben dieses lange erfolgreiche Modell mitgetragen. Aber irgendwann haben sie entschieden, eine Veränderung herbeizuführen.
Aber wäre so eine Zusammenlegung nicht schon früher nötig gewesen, um effizienter zu sein und offensichtliche Reibungsverluste zu vermeiden? Den großen Erfolgsweg über mehr als 20 Jahre gab es mit der früheren Struktur. Denn das FH-Kollegium (samt einem Rektor als Vorsitzendem, Anm.) hat sich erst 2004 gegründet. Erhard Busek war daher auch ab 2004 der erste FH-Rektor. Dieses Miteinander von Rektorat und Geschäftsführung gab es bis 2022; und erst seit Herbst 2002 ist alles in einer Hand. Von 1995 bis 2004 gab es überhaupt nur einen Alleingeschäftsführer an der Spitze - weil wir damals noch keine Voll-FH waren, sondern, wie erwähnt, ein Verein und ab 1997 als GmbH der Betreiber von mehreren FH-Studiengängen. Parallel dazu hat sich auch die Struktur der FH-Leitung weiterentwickelt.
Von den FHs wurde aber mit Fortdauer der Zeit auch immer mehr gefordert, dass sie Forschungsleistungen nachweisen. Wie leicht tut man sich da - wenn die Lehrenden selbst oft teilweise nur einen Magister-Abschluss haben und oft die finanziellen Ressourcen samt Infrastruktur fehlen? Wir sind mit dem Forschungsvolumen sicher an einer gläsernen Decke angelangt, weil die Fachhochschulen keine Basisfinanzierung für die Forschung vom Bund bekommen. Wenn wir erfolgreich forschen wollen und hier größer werden wollen, geht das zulasten der Lehre, weil wir dann die hauptberuflichen Lehrenden von dort in die Forschung abziehen müssen. Aber wir haben dann doppelte Kosten: Denn wir zahlen den Lehrenden und müssen für die Zeit, die er forscht, uns Stunden von externen Lehrenden einkaufen. Unsere Forderung ist daher, eine nachhaltige Finanzierung für die Forschung zu bekommen. Bei uns in Salzburg bringen sich die Träger - seit 2022 ist ja auch das Land Salzburg neben AK und WK zu einem Drittel Mitgesellschafter - hier bereits ein. Aber klar ist: Der Forschungsauftrag steht in einem Bundesgesetz, dem FH-Gesetz, folgerichtig ist der Bund hier zuständig.
Wie gut klappt die Zusammenarbeit mit den Universitäten, die die FHs - auch angesichts der sinkenden Maturantenzahlen - teils als Konkurrenz wahrnehmen? Das eine ist: Wir stehen von Anfang an als freundliche Mitbewerber nebeneinander. Das andere ist, dass wir einen anderen Fokus haben als die Unis: die wirtschaftsnahe, angewandte Ausbildung sowie die konkrete Berufsausbildung. Der dritte Punkt ist, dass wir auch durchaus gemeinsame Studiengänge erfolgreich mit den Unis anbieten. In Salzburg sind das mit der Uni Salzburg die beiden Fächer Angewandte Signalverarbeitung und Human-Computer Interaction. Und ein dritter gemeinsamer Studiengang ist bereits im Gespräch.
In der Theorie können FH-Absolventen anschließend an einer Uni ein Doktorat absolvieren. Das passiert aber in der Praxis nur selten. Warum? Und was würde sich ändern, wenn die FHs das von ihnen geforderte Promotionsrecht hätten? Das zielt in zwei verschiedene Richtungen: FH-Masterabsolventen können seit der Bologna-Erklärung alle einschlägigen Doktoratsstudien an einer Universität aufnehmen. Das ist per Verordnung festgelegt. Dass das bis jetzt nicht massenweise angenommen wird, hängt mit dem stark berufsbezogenen Fokus an den FHs zusammen: Die meisten unserer Absolventen gehen nach dem Masterabschluss in den Beruf; ein Doktoratsstudium qualifiziert aber üblicherweise für eine wissenschaftliche Karriere. Dass die FHs eigene akkreditierte Doktorrats-Studiengänge fordern, hängt nicht mit der Konkurrenzsituation zu den Unis zusammen, sondern hängt mit unserer Forschung zusammen: Denn auch an den Universitäten wird ein wesentlicher Teil der Forschung von den Doktoranden im Rahmen ihres Studiums gemacht. Das ist uns FHs aber verwehrt; wir haben dieses Humankapital für die Forschung nicht. Unser Wunsch-Vorbild ist Bayern: Dort gibt es seit rund zwei Jahren eigene Doktoratskollegs an den FHs; sie sind streng qualitätsgesichert und nur befristet akkreditiert. Das wollen wir auch. Und diese Doktorate sind sehr industrie- und wirtschaftsnah und bedingen eine Kooperation mehrerer FHs. Daher unterscheiden sie sich auch klar von den Doktoraten den Unis und wären keine Konkurrenz.
Neu ist, dass sich die FHs durch die jüngste Gesetzesnovelle auf Wunsch auch "Hochschule für angewandte Wissenschaften" nennen dürfen. Ist da mehr als Eitelkeit dahinter? Ja. Ich persönlich finde diese Entwicklung gut. Denn es ist auch ein Schritt zur Klarstellung der Eigenständigkeit der Fachhochschulen innerhalb des tertiären Sektors.
Wie wird der FH-Sektor in 30 Jahren aussehen? Ich bin überzeugt, dass die österreichische Industrie und Wirtschaft weiterhin Hochschulpartner braucht, die ihre Sprache verstehen: Leistung, Ergebnis und Performance. Das sind wir. Und deshalb wird die Existenznotwendigkeit für Fachhochschulen auch im Jahr 2054 weiterhin bestehen - wie auch schon 1994.