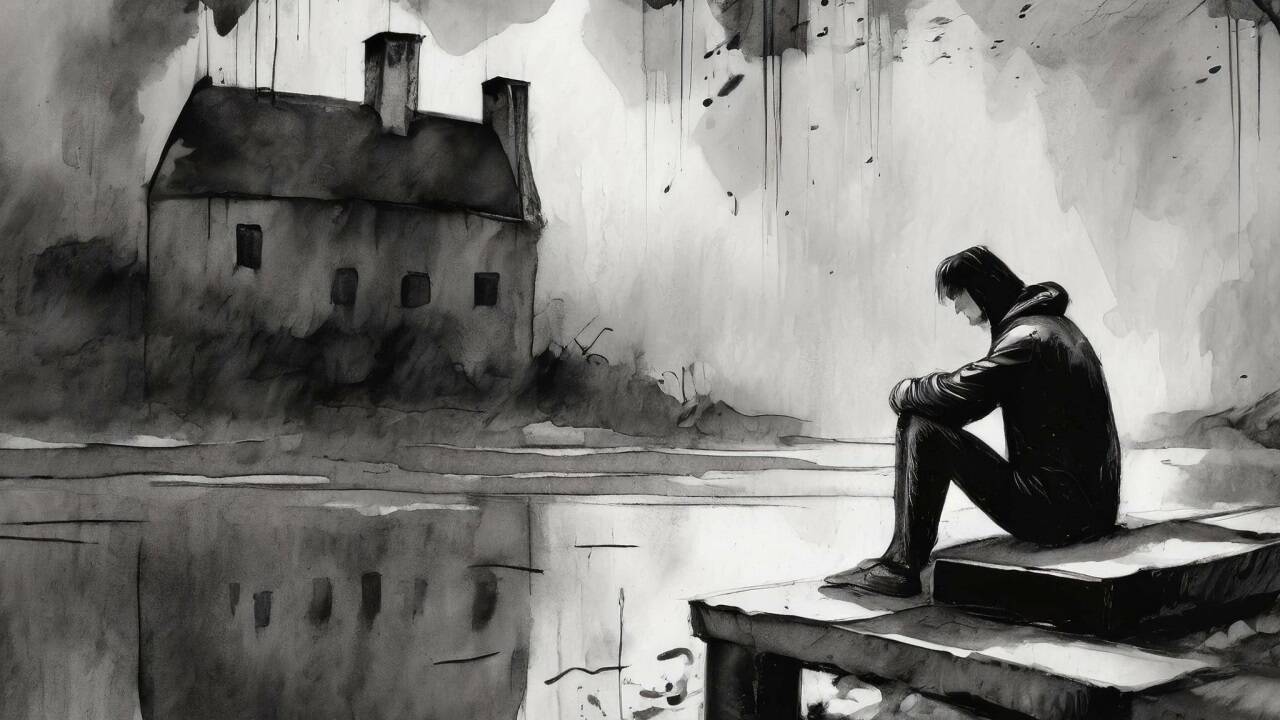Das Herz rast, die Hände zittern, das Atmen fällt schwerer: Nimmt ein Gefühl der Angst überhand, kann der menschliche Körper mit einer Panikattacke reagieren. Ein solcher Anfall kommt mit Wucht und lässt Betroffene mitunter denken, dass sie sterben. Und das Problem ist beileibe kein seltenes: Es wird geschätzt, dass rund 30 Prozent der Menschen im Lauf ihres Lebens eine Panikattacke erleiden.
"Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie einen Alarm, der von einer Alarmanlage ausgelöst wird. Das geht ganz schnell von 0 auf 100", erklärt der Leiter der Angstambulanz der Berliner Charité, Andreas Ströhle. Bei einer Panikattacke komme es zu einer Aktivierung bestimmter Hirnregionen. "Für diese körperlichen Reaktionen sind der Hirnstamm und die physiologischen Zentren im Gehirn verantwortlich, die den Kreislauf und die Atmung regeln." Diese stammesgeschichtlich alten Zentren seien für Reaktionen wie einen beschleunigten Puls, Atemnot oder Schwitzen mitverantwortlich. Werden diese Prozesse in Gang gesetzt, komme es im Körper zu einer massiven Reaktion, erläutert Ströhle. Diese führe dazu, "dass sich der Körper auf eine Bedrohung einstellt".
Doch warum kommt es zu solchen Attacken? Ströhle nennt etwa psychische und körperliche Erkrankungen, Lebensereignisse und auch Drogen wie Alkohol oder Beruhigungsmittel als Gründe. Vermehrter Kaffeekonsum, Schlafdefizit, Stress oder bestimmte Medikamente können ebenso begünstigend wirken. Überdies gebe es situativ ausgelöste Anfälle: Hat man etwa eine Schlangenphobie und wird mit dem Tier konfrontiert, kann es zu einer Panikattacke kommen.
Dabei sei aber wichtig, zwischen einer Panikattacke und einer Panikstörung zu unterscheiden. Die Attacke könne auch bei gesunden Menschen auftreten, etwa bei einer starken Bedrohung. Hinter einer Panikstörung indes steckt eine ernsthafte Erkrankung, bei der es wiederholt zu unerwarteten Attacken kommt. Ströhle berichtet, dass sich diese Erkrankung aber gut behandeln lässt. Dabei kämen eine Psychotherapie, vor allem Verhaltenstherapie, und zusätzlich oder stattdessen Antidepressiva zum Einsatz.