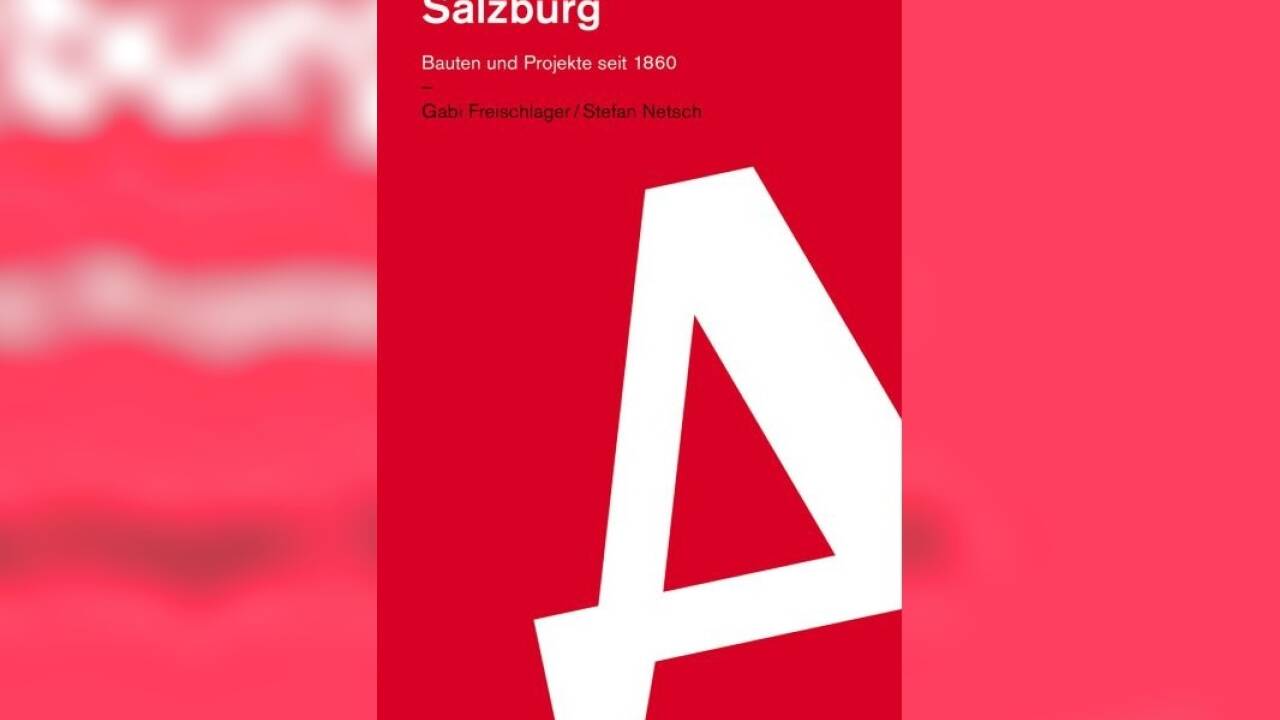Dass Salzburg eine bestens erhaltene barocke Altstadt hat, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass hier auch tolle moderne Architektur steht, die internationale Vergleiche nicht zu scheuen braucht. Die Stadtführerin Gabi Freischlager und der Baukulturexperte Stefan Netsch wollten das ändern - und haben nun den "Architekturführer Salzburg" herausgegeben: Er zeigt, auch mit vielen Fotos, 150 Beispiele moderner Architektur, aufgeteilt auf zehn Spaziergänge. Wobei: "Modern" geht in diesem Buch schon mit 1860 los: "In diesem Jahr startete die urbane Entwicklung Salzburgs mit dem Bau des Bahnhofs; zudem wurde die Salzach reguliert und die sternförmige Festungsmauer, die auch das Schloss Mirabell umfasst hat, abgerissen", sagt Kunsthistorikerin Freischlager. Der Hauptfokus auf den 272 Seiten liege aber auf (Wohn-)Bauten und Quartieren nach 1945 und hier primär auf jenen in den damals neuen, peripheren Stadtteilen Lehen, Taxham oder Maxglan, sagt Netsch: "Für Architekturinteressierte wie mich ist ja das Drumherum viel interessanter als die Altstadt", sagt der aus der Pfalz stammende Stadtplaner augenzwinkernd. Folgerichtig wurde das Kapitel 1 mit "Salzburg - mehr als nur Barock" übertitelt.
Netsch, der den Studiengang "Smart Cities" an der Fachhochschule leitet, betont, dass viele moderne Bauten in der Mozartstadt mit internationalen Vorbildern gut mithalten könnten: "Das ist vielen Einheimischen gar nicht bewusst." Auch Freischlager sagt, dass sie als Stadtführerin laufend Anfragen von internationalen Architekturbüros oder auch Schulen habe, "die sich bei uns modernen, hochqualitativen sozialen Wohnbau ansehen wollen, weil es den bei ihnen zu Hause gar nicht gibt."
Aber: Wieso haben viele Salzburger anscheinend ein schwieriges Verhältnis zu moderner Architektur? Warum sind Neubauten, die auch in ihrem Buch enthalten sind, oft umstritten - vom Heizkraftwerk Mitte über die Wohnbauprojekte am Stadtwerke- und Riedenburg-Areal bis zur General-Keyes-Siedlung? Freischlager meint, dass Salzburg mit dem Weltkulturerbe "einen tollen Bauschatz hat. Den will man auch bewahren." Netsch meint, diese Skepsis könnte auch daran liegen, dass Salzburg in puncto Bevölkerungswachstum seit Jahren stagniere und daher manche Bewohner mit Veränderungsdruck ein Problem hätten. Im Vergleich dazu würde sich etwa Linz auch baulich viel dynamischer entwickeln. Auch universitär tue sich dort mehr - etwa mit der neuen Digitaluni IT:U. "An der Linzer Kunstuni gibt es eine auf zwei Leute aufgeteilte Professur für Baukultur; die bräuchten wir eigentlich in Salzburg."
Ist es nicht generell schwierig, eine barocke Altstadt und weitere historische Gebäude außerhalb davon mit modernen Bauten aus Glas und Stahl zu kombinieren? Freischlager betont, dass zeitgenössische Architektur immer schwierig sei, "weil es keine Vorbilder dafür gibt. Und mit allem, was neu ist, muss man sich auseinandersetzen." Netsch sagt, dass die Akzeptanz für moderne Bauten umso mehr steige, je besser sie auch den Bewohnern dienten. Als Positivbeispiel nennt er das Stadtwerkeareal: "Da gibt es im Erdgeschoß viele Einrichtungen, die wichtig für Lehen sind, den Stadtteil bereichern und hochwertige Arbeitsplätze bieten; von der Volkshochschule über die Labors; die Galerie Fotohof bis zu Integrationsfonds und PMU."
Abgerundet wird das Buch mit einem Interview mit Roman Höllbacher (Initiative Architektur), der auch den Wert von Unesco-Weltkulturerbe und Gestaltungsbeirat anspricht. Auch Netsch betont die Leistung des 1983 initiierten Beirats: Diese liege nicht nur in der belegbaren Qualitätssteigerung der Architektur Salzburgs, "sondern in der - nicht sichtbaren - Verhinderung qualitätsloser Planungsvorhaben".
Beispiele für modernes Bauen in Salzburg
Welche Positivbeispiele gefallen Netsch und Freischlager in puncto moderner Architektur in Salzburg? Die beiden Autoren nennen hier spontan zunächst die Generalsanierung der Friedrich-Inhauser-Straße: "Gerade die Inhauser-Straße zeigt den Umgang mit aktuellen Themen wie ressourcenschonendem, flächensparendem Bauen, das auch dem Klimaschutz dient", sagt Netsch. Denn gute Architektur müsse nicht nur schön sein, sondern "auch bei der Nutzung wandlungsfähig und Jahre später noch adaptierbar sein", sagt er. Freischlager hebt zudem die Nachverdichtung der Generel-Keyes-Straßen-Siedlung hervor, weil hier vorbildlich mit Nachkriegs-Bausubstanz umgegangen worden sei: "Schön wäre, wenn die bestehende Museumswohnung auch öffentlich zugänglich gemacht werden könnte."