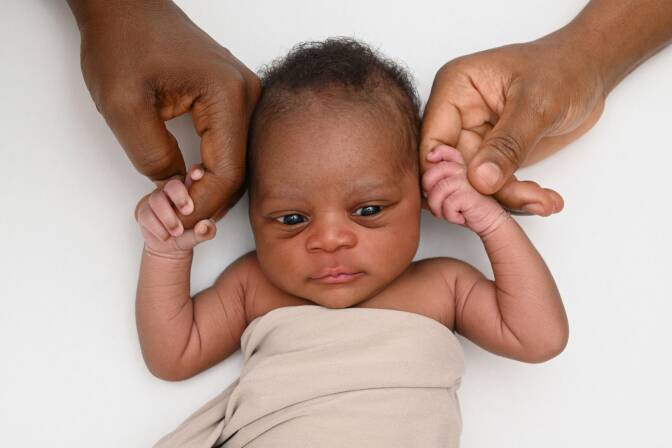Nach dem Kollegium der Mittelschule Taxham begehren in dem Stadtteil nun die Lehrerinnen und Lehrer der Anna-Bertha-Königsegg-Schule auf. Auch sie machen in einem Schreiben nachdrücklich auf die Situation in ihrer Schule aufmerksam. Rund 70 Kinder und Jugendliche - sie sind 6 bis 18 Jahre alt - besuchen diese Sonderschule für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf. Sie alle sind geistig beeinträchtigt, stark gestiegen ist die Zahl von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung.
Immer wieder Gewalt gegen Lehrkräfte und Personal
An die Grenzen bringt das Personal, dass in der Schule die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen steigt und dass es auch immer wieder zu Gewalt gegen Lehrkräfte und anderes Personal kommt. Seit Schulbeginn wurden drei Schüler nach der Ausübung von Gewalt suspendiert, nachdem jahrelang mit allen zur Verfügung stehenden pädagogischen Mitteln versucht worden war, eine Verhaltensveränderung zu bewirken. "Seit einigen Jahren wird die Anzahl von fremdverletzenden Schülern immer größer, die Möglichkeiten und Ressourcen, auf diese zu reagieren, sie in einer Klasse einzugliedern und körperlichen und psychischen Schaden von Mitschülern und Personal abzuwenden, werden immer unzureichender", heißt es in dem Brief. In Krisengesprächen, Helferkonferenzen und anderen Gremien habe man immer wieder auf die ernste Lage hingewiesen. "Leider wurden wir nicht gehört."
Schwer verhaltensauffällige Kinder in vielen Klassen
"Früher hatten wir alle paar Jahre ein schwer verhaltensauffälliges Kind, doch mittlerweile haben wir diese Kinder in vielen Klassen", schildert eine langjährige Lehrerin. Diese Kinder hätten zu Hause nicht gelernt, Grenzen oder ein Nein zu akzeptieren, die Eltern seien mit der Erziehung überfordert und bräuchten selbst Hilfe. Auch sie sei schon einmal nach der Jause von einem 14-jährigen Schüler mit einem spitzen Obstmesser bedroht worden. Nur in wenigen der 13 Klassen könne überhaupt noch so etwas wie Unterricht stattfinden.
Bildungsdirektion verweist stets auf die Schulpflicht
Obwohl die Lehrkräfte Expertinnen und Experten im Umgang mit sogenannten Systemsprengern seien, würden sie schon lange an ihre Grenzen stoßen, ist in dem Brief zu lesen. Es sei nicht mehr möglich, die Sicherheit der Schüler und des Personals zu gewährleisten. Trotz aller zur Verfügung stehenden Mittel - von Suspendierungen und Ausschlusskonferenzen über Krisenteams sowie intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit - würden diese Schüler mit immer denselben zwei Begründungen in die Schule zurückgeschickt. Die Bildungsdirektion verweise stets auf die Schulpflicht und darauf, dass es keine andere Schule gebe, die diese Schüler aufnehmen könne. Pädagogische Einwände würden nicht gehört.
"Egal was in den vier Wochen einer Suspendierung passiert, ob die Eltern die Zeit einfach absitzen oder händeringend nach Hilfe suchen, ist der Rechtsabteilung der Bildungsdirektion scheinbar völlig egal." Das einzige Argument sei die Schulpflicht. Manche Gespräche würden wie eine Verhandlung anmuten, in der "geschachert" werde, um den Schüler möglichst "billig" wieder an die Schule zu schicken.
Aus Sicht des Personals sind viele der Kinder nicht schulfähig. "Man kann sie in keine Gruppe geben, sie bräuchten Ruhe, Unterstützung zu Hause und Einzelbetreuung", sagt eine Lehrerin.
Dienstbehörde soll Arbeitnehmerschutz ernst nehmen
"Wenn die Kinder mit schweren psychischen Störungen und schwer fremdverletzendem Verhalten in der Schule bleiben, brauchen wir Ressourcen in Form von deutlich mehr Lehr- und speziell ausgebildetem Betreuungspersonal", sagt Schulleiterin Manuela Hanusch. "Wir brauchen dringend Unterstützungsmaßnahmen wie etwa die unbürokratische Möglichkeit einer Einzelbetreuung, die gesetzliche Verankerung von Ergotherapiestunden, ein fixes Kontingent an Stunden für Schulpsychologie, Supervisionsstunden ohne Selbstbehalt sowie Schulsozialarbeiter als Mittler und Unterstützer für die Familien, die ebenfalls nicht mehr weiterwissen." Schon lange fehle im Land Salzburg die Möglichkeit, Kinder gemeinsam mit einem Elternteil für mehrere Wochen stationär in einer Klinik aufzunehmen und medizinisch sowie therapeutisch zu behandeln.
Die Lehrkräfte fordern, dass die Dienstbehörde den Arbeitnehmerschutz ernst nimmt und dass das Recht der Schüler auf Unterricht und Unversehrtheit im Schulalltag ohne Einschränkungen möglich gemacht werden kann. "Wir brauchen einen Dienstgeber, der unsere Sorgen und Probleme ernst nimmt, uns unterstützt und gemeinsam mit uns nach Lösungen sucht, der keinen Druck ausübt und der uns nicht mit Argumenten wie ,Das ist überall so' und ,Das muss funktionieren' mundtot und handlungsunfähig machen möchte."
Strategie soll festgelegt werden
Es handle sich hier um eine Schule mit besonderen Verhältnissen, sagt Bildungsdirektor Rudolf Mair. "Die Kinder haben einen erhöhten Förderbedarf und zeigen bedingt durch ihre Behinderung und nicht sozial determiniert Verhaltensweisen, die herausfordernd sein können." Es bestehe die Notwendigkeit, fachlich richtig zu handeln, um die Schule bestmöglich zu unterstützen. Daher lädt Mair am Dienstag zu einer internen Besprechung. Teilnehmen werden daran außer ihm Primar Klaus Kranewitter vom Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik und Therapie, das Sonderschulen fachärztlich berät, sowie die Schulaufsicht und ein Diversitätsmanager, der für den Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik zuständig ist. In dieser Runde soll eine Strategie festgelegt werden. "Mein Ansinnen ist, verlässliche Informationen und einen Lagebericht zu bekommen", betont Mair. Prüfen wolle er auch, warum für viele der Schüler die Unterrichtszeit reduziert sei. Nach Weihnachten werde gemeinsam mit der Schule ein Fahrplan festgelegt, kündigt Mair an.
Zahl der Suspendierungen an allen Pflichtschulen seit 2022/23 verdoppelt
Insgesamt hat sich seit dem Schuljahr 2022/23 die Zahl der Suspendierungen an allen Pflichtschulen im Bundesland verdoppelt. In den zehn Jahren davor wurden im Schnitt 40 bis 60 Kinder pro Schuljahr suspendiert, nun sind es 80 bis 120. Die meisten sind Burschen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Ziel müsse sein, Kindern möglichst früh Hilfe angedeihen zu lassen, meint Mair. Beim Eintritt in die Schule sei in der Entwicklung schon vieles grundgelegt.