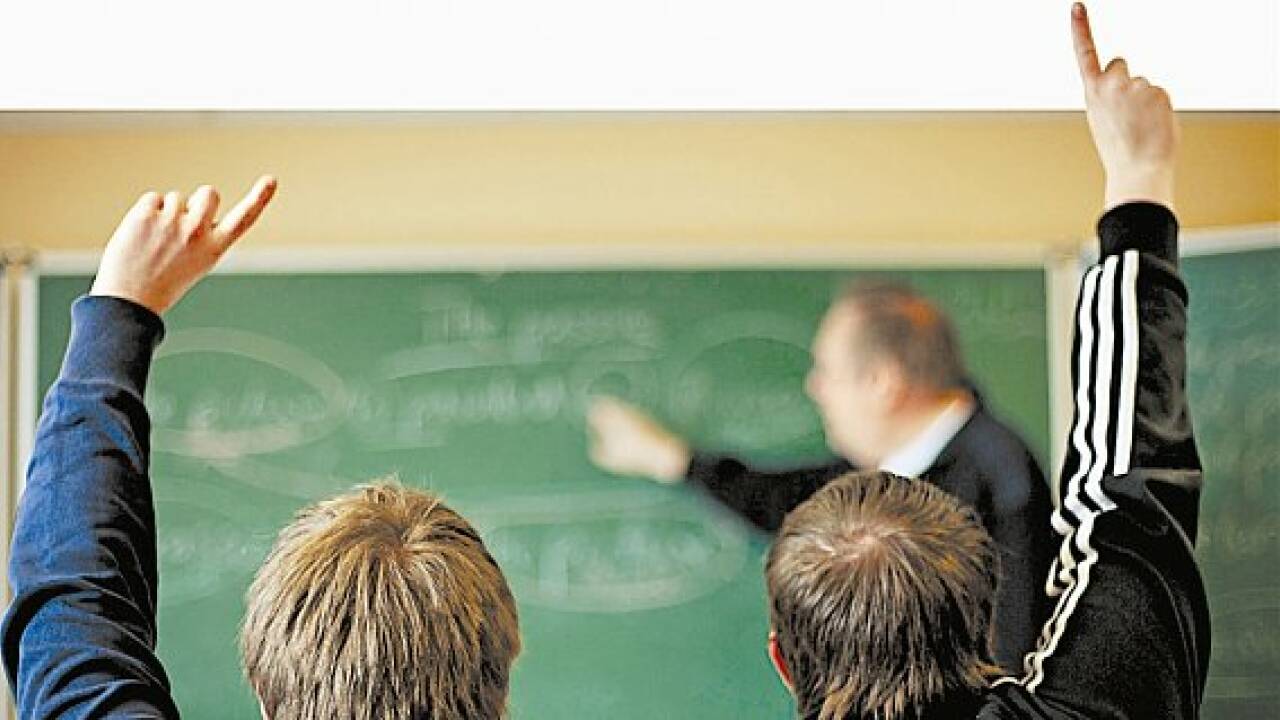Die "Hattie-Studie" ist die größte Bildungsstudie, die es je gab. Sie fasst mehr als 800 Metastudien zusammen, die auf 50.000 Einzelstudien beruhen, an denen gut 2,5 Millionen Schüler teilnahmen - aber nur aus dem englischsprachigen Raum. Klaus Zierer, Professor für Erziehungswissenschaften an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg erklärt im SN-Interview, weshalb sie für Österreich trotzdem relevant ist und warum er sie übersetzt hat.
SN: Es ist nichts Neues, dass die Lehrer für den Lernerfolg der Schüler entscheidend sind. Warum regt die Hattie-Studie so auf?
Klaus Zierer: Weil sie eine Synthese von Meta-Analysen ist, die auf einen bisher noch nie in dieser Größe ausgewerteten Datensatz zurückgreift. Für John Hattie ist der entscheidende Punkt, sich im Bildungssystem auf das zu konzentrieren, was empirisch nachweisbar ist, um so wegzukommen von bisher emotional aufgeladenen Debatten. Er definiert dazu 138 Faktoren und bringt sie in eine Rangfolge. Damit macht er deutlich, was im Schulalltag nicht nur wirkt, sondern was am besten wirkt. Dem Lehrer kommt da eine besondere Bedeutung zu. Allerdings warnt Hattie davor, dass es nicht reicht, einzelne Faktoren herauszugreifen, weil alle zusammenhängen. Deshalb kann man Sitzenbleiben beispielsweise nicht verteufeln, auch wenn es durchschnittlich betrachtet einen negativen Effekt hat.
SN: Sondern?
Zierer: In gewissen Fällen kann eine Nichtversetzung der bessere Weg sein, etwa wenn ein Schüler längere Zeit krank war. Zudem ist offen, ob eine Abschaffung des Sitzenbleibens für die, die nicht sitzenbleiben, negative Effekte haben kann. Eine individuelle Förderung ist in jedem Fall geboten. Ähnlich verhält es sich mit Schulstrukturdebatten. Wir können weiterhin diskutieren, ob die Volksschule vier oder sechs Jahre dauern soll, ob es eine Differenzierung in Hauptschulen und Gymnasien oder ob es kleinere Klassen geben soll. All das bringt nicht die erhofften Effekte und ist insofern zweitrangig. Man kann darüber natürlich diskutieren. Was aber gefährlich ist, ist der Umkehrschluss. Nehmen Sie die kleineren Klassen, die man vergrößern könnte. Das wäre eine falsche Interpretation. Größere Klassen können zu negativen Effekten führen, nämlich genau dort, wo es ankommt: im Unterricht. SN: Hat die Bildungspolitik sich also auf das Falsche konzentriert?
Zierer: Ganz falsch sicherlich nicht. Aber verkürzend war es, sich fast ausschließlich auf Strukturen zu konzentrieren, anstatt Geld in den Lehrer und seine Ausbildung zu investieren. Lehrer haben nach der Hattie-Studie den größten Einfluss auf die Schüler.
SN: Was macht gute Lehrer aus?
Zierer: Hattie sieht im guten Lehrer einen "Activator", was wir mit "Regisseur" übersetzt haben. Ihm stellt er einen "Faciliator", übersetzt als "Moderator", gegenüber. Gute Lehrer wissen genau über den Lernfortschritt ihrer Schüler Bescheid. Das funktioniert nur mit regelmäßigem Feedback, das nicht nur vom Lehrer an den Schüler geht, sondern umgekehrt auch vom Schüler an den Lehrer. Diese Sichtweise müssen angehende Lehrer von Anfang an im Studium vermittelt bekommen.
SN: Lässt sich die Studie überhaupt eins zu eins auf Österreich und Deutschland umlegen?
Zierer: Um diese Frage zu klären, haben wir sie übersetzt. Damit erleichtert wird, von welchen Begriffen die Rede ist. Die wichtigsten Faktoren - die Selbsteinschätzung der Schüler, die Lehrer-Schüler-Beziehung, das Feedback - lassen sich ohne größere Probleme übertragen. Bei manchen, wie die Sommerferien, die in Teilen der USA drei Monate dauern, oder Lehrerhausbesuchen, die wir nicht haben, geht das nicht. Man muss also genau hinschauen.
Hattie-Studie
Die Schule zerlegt in 138 Faktoren
15 Jahre hat der neuseeländische Erziehungswissenschafter John Hattie gebraucht, um die bisher größte Meta-Bildungsstudie zu erstellen. Hattie wertete anhand von 138 Faktoren - vom Elternhaus über die Feriendauer und die Klassengröße bis zur Selbsteinschätzung der Schüler - statistisch aus, was sich tatsächlich im Klassenzimmer auswirkt. Sein Ergebnis: das gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis, das durch gegenseitige regelmäßige Rückmeldungen entsteht, hat die größten Effekte. Dagegen wirken sich Lehrpläne, Unterrichtsformen (Frontal- oder Kleingruppenunterricht) oder die Struktur des Schulwesens (Gesamtschule oder Hauptschule/Gymnasium) kaum auf den Bildungserfolg aus.
John Hattie, Wolfgang Beywl, Klaus Zierer: "Lernen sichtbar machen", 439 Seiten, 28 Euro, Schneider Verlag Hohengehren