Der Vergleich macht sicher. 2022 sind die Verbraucherpreise im Sog des russischen Angriffs auf die Ukraine und nach Energiepreisausschlägen um 8,6 Prozent gestiegen, 2023 noch einmal um 7,8 Prozent. Im Vorjahr lag Österreichs Inflationsrate bei vergleichsweise bescheidenen 2,9 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Der Preisanstieg lag damit aber immer noch um 0,5 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt und deutlich über dem Zwei-Prozent-Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB).
Die Inflation hat sich 2024 stark abgebremst - jetzt nimmt sie wieder Fahrt auf
Die Verbraucherpreise haben im Vorjahr um 2,9 Prozent zugelegt. Österreich liegt damit weiter über dem EU-Durchschnitt, hat sich aber verbessert. Was sind die Gründe dafür?
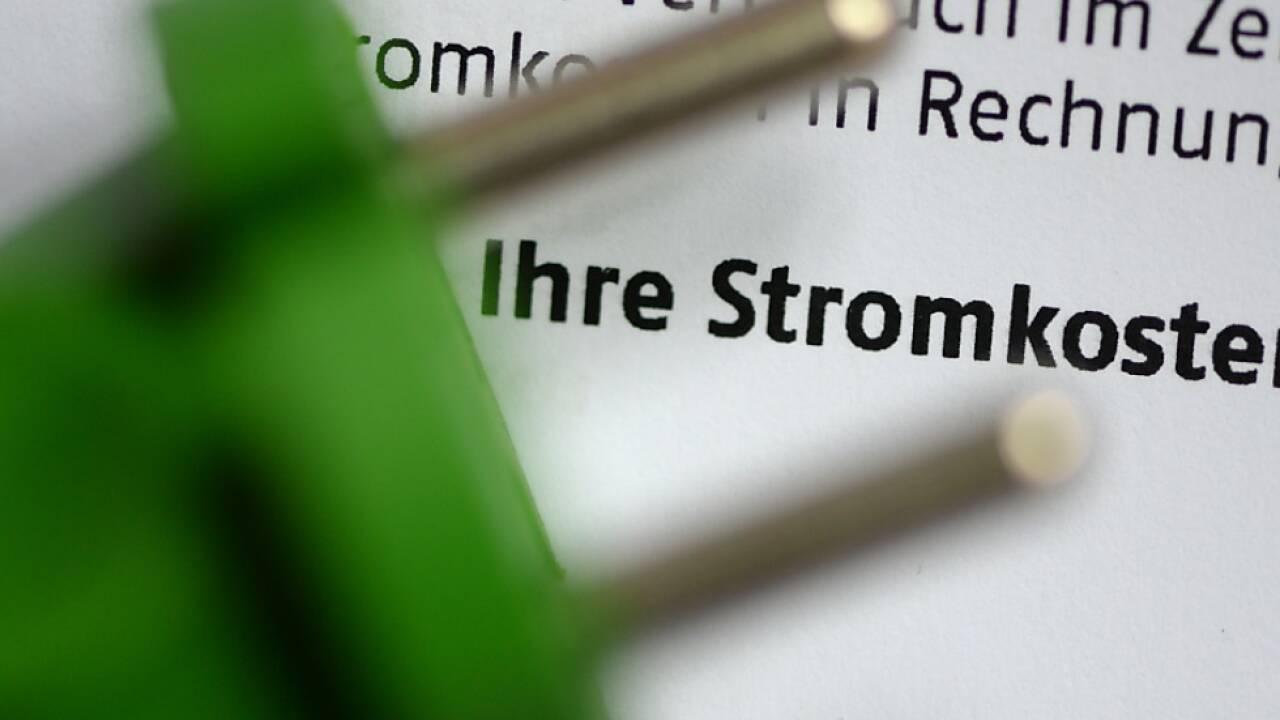
Die Teuerung habe sich stärker eingebremst als in den meisten anderen Ländern des Euroraums, unterstrich Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas bei der Präsentation der Zahlen. Im Jahresverlauf 2024 ging sie von 4,6 Prozent im Jänner kontinuierlich auf 1,8 Prozent im September und Oktober zurück. Im November stieg sie wieder leicht auf 1,9 Prozent und im Dezember auf 2,0 Prozent. Treiber Nummer eins war erneut die Gastronomie, wo die Preise dreimal stärker als die gesamten Verbraucherpreise stiegen, zugleich fiel der dämpfende Effekt bei den Treibstoffpreisen geringer aus.
Im Jänner dürfte sich dieser Trend drastisch verstärken: Denn mit Jahresbeginn sind sämtliche staatliche Stützungen zur Eindämmung der Energiepreise - vor allem die Strompreisbremse, aber auch die Absenkung beziehungsweise Aussetzung von Abgaben - ausgelaufen und die Netztarife und die CO2-Abgabe sind gestiegen. Wie sich das auswirken wird, dazu geben die Statistik-Experten keine Prognosen ab. Jedenfalls werde die Inflationsrate im Jänner aber steigen, sagt der Leiter der Direktion Volkswirtschaft, Ingolf Böttcher. Wären die Maßnahmen schon im Dezember ausgelaufen, hätte die Inflation 3,3 statt 2 Prozent betragen.
Nach früheren Schätzungen der Wirtschaftsforscher werden die höheren Energieausgaben im Jänner die Teuerung um rund einen Prozentpunkt antreiben. Aus Sicht von Agenda-Austria-Ökonom Jan Kluge wäre es dennoch völlig falsch, sollte die nächste Regierung hier noch einmal staatliche Hilfen überlegen. "Die Zeit, da einzugreifen, ist wirklich vorbei und wäre wahrscheinlich schon früher vorbei gewesen", sagt er - nicht nur, weil der Spielraum im Budget ohnehin nicht gegeben sei.
2024 waren die Energiepreise die größten Inflationsdämpfer. Sie sind um 6,9 Prozent gesunken - nachdem sie im Jahr davor noch um 16 Prozent nach oben gegangen waren. Bei Erdgas und Holz gingen die Preise rund 17 Prozent nach unten, nach einer Steigerung um mehr als die Hälfte 2023. Die Strompreise sind ganz leicht gestiegen. Deutlich verteuert haben sich im Vorjahr hingegen erneut die Mieten: konkret um 6,7 Prozent, nach plus 7,9 Prozent 2023 - also in zwei Jahren um fast 15 Prozent.
Die Preisanstiege bei Dienstleistungen, zu denen in der Statistik neben Gastronomie, Versicherungen, Freizeit und Kultur auch das Vermieten zählt, waren 2024 laut Böttcher für rund 90 Prozent der Inflation verantwortlich. Bewirtungsdienstleistungen wurden um 7,1 Prozent teurer, beispielsweise Wein im Durchschnitt um 6,4 Prozent, Cocktails um 7,5 Prozent und das panierte Schnitzel durchschnittlich um 7,2 Prozent.
Deutlich verlangsamt - von 11,0 auf 2,6 Prozent - hat sich die Teuerung bei Lebensmitteln. Eine Ausnahme bildete hier Olivenöl, das sich nicht zuletzt wegen schlechter Ernten um 34,5 Prozent verteuerte. Auch bei alkoholfreien Getränken kletterten die Preise mit plus 6,8 Prozent weiter nach oben. Für den täglichen Einkauf (Mikrowarenkorb) mussten die Österreicher um 4,3 Prozent mehr hinlegen als im Jahr davor, für den wöchentlichen Einkauf 3,4 Prozent mehr. Das tägliche Leben hat sich also weiter überdurchschnittlich verteuert. Günstiger wurden erneut Kommunikationsdienstleistungen.
Anders als etwa in Deutschland wurde die Inflation in Österreich aber beinahe vollständig durch Lohn- und Gehaltssteigerungen kompensiert, wie Statistik-Chef Thomas sagt. In den vergangenen vier Jahren seien die Tariflohnsteigerungen hierzulande mit 23,6 Prozent doppelt so hoch ausgefallen wie im Nachbarland (11,8 Prozent) - während die Teuerung von 2020 bis 2024 bei 25,1 Prozent in Österreich bzw. 19,1 Prozent in Deutschland lag. "Das wirkt sich schon auf die Wettbewerbsfähigkeit aus."
Für die Arbeitnehmer sei es erfreulich, dass Österreich durch die geringere Inflation nun in Bereiche komme, wo die Reallohnverluste der Vergangenheit überkompensiert würden, sagt Agenda-Experte Kluge. Für die Unternehmen seien die dramatisch höheren Arbeitskosten dagegen schon schwierig zu tragen - gemeinsam mit der Bürokratie und dem Fachkräftemangel. Einmalzahlungen oder andere temporäre Abfederungen habe die Gewerkschaft abgelehnt. "So schleppen wir das Problem weiter." Von staatlicher Seite könnte man aber den Abgabenfaktor auf Arbeit - "einer der höchsten der Welt" - senken, indem etwa ein Teil der derzeitigen Lohnnebenkosten aus allgemeinen Steuermitteln finanziert würde.
Für das Gesamtjahr gehen die Wirtschaftsforscher von einem Rückgang der Inflation auf 2,3 (Wifo) bzw. 2,6 (IHS) Prozent aus. Das niedrigere Zinsniveau, vor allem aber die schwache Konjunktur spreche für eine geringe Teuerungsrate, sagt auch der Chef der Statistik Austria.