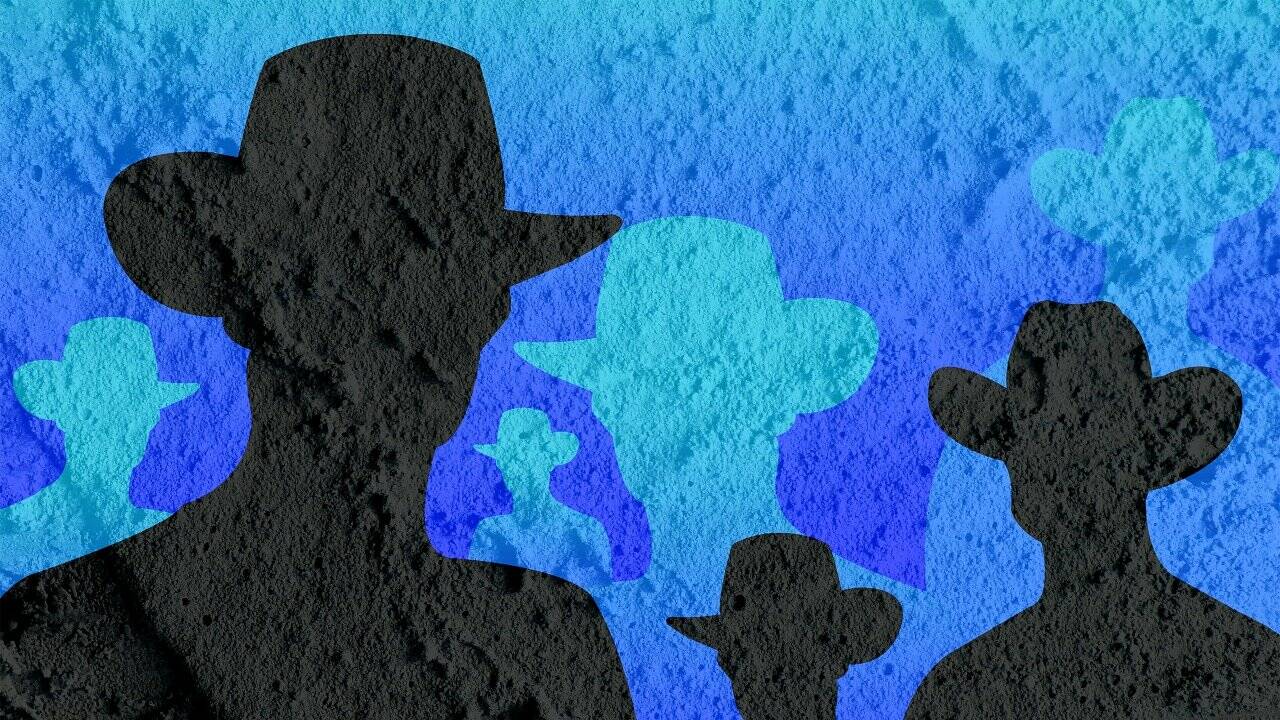Ein Jahr ist es her, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) das "Recht auf Vergessenwerden" im Internet anerkannt hat. Ein Urteil, das sich vor allem gegen die Suchmaschine Google richtete. Das Recht gibt Bürgern die Möglichkeit, die Löschung persönlicher Daten durchzusetzen, wenn sie sich in Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Die Initiative zur gerichtlichen Entscheidung ging aber nicht von der Politik aus. Geklagt hatte ein Spanier, der die Verbindung seines Namens mit einer lange zurückliegenden Zwangsversteigerung als Verletzung seines Persönlichkeitsrechts ansah.
Seit der vergangenen Woche ist ein Verfahren mit gleicher Tragweite im Laufen. Und auch dieser Prozess wird von einem Privaten bestritten. Der Salzburger Datenschutzaktivist Max Schrems will mit einer Musterklage gegen das Onlinenetzwerk Facebook vorgehen. Als Gipfel seiner Bemühungen um den Datenschutz in sozialen Netzwerken. Denn Schrems versteht es seit Jahren, Facebook und die Datenschutzbehörde von Irland, wo Facebook den europäischen Firmensitz hat, zu provozieren. Erst forderte er die Herausgabe aller Daten, die das weltgrößte Onlinenetzwerk über ihn gespeichert hat. Auf dieser Basis warf er Facebook vor, auch "gelöschte" Daten behalten zu haben, und klagte bei der irischen Datenschutzkommission. Nach drei Jahren hat Schrems die Beschwerden auf Anraten seiner irischen Anwälte zurückgezogen. "Die Behörde hat de facto jede Kommunikation eingestellt und alle Eingaben ignoriert", schreibt Schrems auf seiner Website.
Nun strengt Schrems eine Sammelklage gegen Facebook vor einem österreichischen Gericht an. 25.000 Personen sollen sich bereits der Klage angeschlossen haben.
Doch warum bekommt Schrems kaum Unterstützung von der Politik? Warum reagiert die nur dann sensibel auf Datenschutzfragen, wenn Handys von Politikern abgehört werden? Warum nimmt die Politik die Sache nicht überhaupt selbst in die Hand? Und warum zeigt sich bei den aktuellen Verhandlungen um die Datenschutzreform auf europäischer Ebene gar, dass viele Politiker keine strenge Regulierung wollen?
Eine Interpretation wäre, dass Politiker ohnehin willfährige Erfüllungsgehilfen von Polizei und Geheimdiensten sind, die jeden Bürger grundsätzlich unter Verdacht stellen und deshalb mit Bürgerrechten nichts am Hut haben. Die Verschwörungstheoretiker dieser Welt lassen grüßen.
Eine viel einfachere Erklärung für die Untätigkeit der Politik gab jüngst CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, Tochter des bayerischen Übervaters Franz Josef Strauß, im Bayerischen Fernsehen: "Ich glaube, wir als Europäer würden uns an der Informationsgesellschaft, wie sie sich derzeit entwickelt, vorbeientwickeln. Und wir würden vor allem dafür sorgen, dass junge Start-ups keine Chance haben, sich am europäischen Markt zu entwickeln."
Moment, aber das wollen wir doch! Wir wollen uns an dem, wie es derzeit läuft, vorbeientwickeln. Denn so, wie es sich derzeit entwickelt, ist es unerträglich: Da wird das Internet zur gesetzlosen Zone erklärt, damit sich dort die Wirtschaft schrankenlos entfalten kann. Dieser Ansatz wäre nur dann berechtigt, wenn Entwicklungen im Internet kaum Auswirkungen auf unser Leben hätten. Wenn es ein Platz für Sandkastenspiele wäre.
Das Internet ist mittlerweile aber so eng mit unserem Alltag verwoben, dass damit auch weite Bereiche unseres Lebens in einer gesetzlosen Zone stattfinden. Es wird absichtlich eine Wildwestmanier an den Tag gelegt, damit nur ja keiner einen wirtschaftlichen Nachteil davonträgt. Dass damit auch tief in unser gesellschaftliches Wertesystem eingegriffen wird, nimmt die Politik offenbar in Kauf. Neue Technologien verändern die Gesellschaft, das ist klar. Doch könnte man auch in Betracht ziehen, neue Technologien auf Basis bestehender Werte zu entwickeln. Dafür setzen sich unermüdliche Datenschutzaktivisten wie Max Schrems ein. Solches Engagement von Privatpersonen muss möglichst bald von offizieller Seite gewürdigt und unterstützt werden.