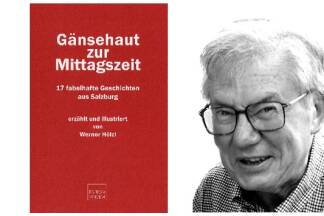Wie mühelos es doch heute selbst für Männer ist, eine Waschmaschine in Gang zu bringen. Daher können sich immer weniger Menschen vorstellen, wie früher Wäsche gewaschen wurde und welche Mühen damit verbunden waren. Da war gleich ein ganzer Tag damit ausgefüllt, auf größeren Bauernhöfen sogar für mehrere Personen. Und ausschließlich Frauen waren für diese Plackerei zuständig - Mannsbilder hat man dabei nie angetroffen. Darüber hinaus gab es in früheren Zeiten auch keine vorgefertigten Waschmittel und Seifen; diese wurden mit erheblichem Aufwand selbst hergestellt. Deshalb kein Wunder, wenn einige Leute oft eine Woche lang das gleiche Hemd anhatten, an deren Unterwäsche mag man gar nicht denken - oder sich vorzustellen, dass manche wie brünstige Ziegenböcke gerochen haben. No, guade Nocht!
Jedenfalls hat man in diesen waschmaschinenlosen Zeiten die Wäsche vor dem Waschen eingeweicht. Der billigste Zusatz war Holzasche - bevorzugt jene von verbranntem Akazienholz. Diese wurde in einem Polsterüberzug über den Rand eines Bottichs geschlagen und mit heißem Wasser überbrüht. Aus dieser unansehnlichen Brühe entstand eine scharfe Lauge, die über Nacht auf die Wäsche schmutzlösend einwirkte. Tags darauf wurde diese auf Waschrumpeln gewalkt und gerieben, manch grindige Partien kräftig gebürstet, um sie hernach in einem mit Lauge gefüllten Kessel auszukochen. Das geschah in eigenen Waschküchen oder Waschhäusln, in verzinkten Eisenkesseln, eingelassen in gemauerten Feuerherden. Hernach wurden die dampfend heißen Teile mit langstieligen Holzlöffeln herausgefischt und in kaltem Wasser geschwemmt, entweder in einem großen Schaff oder in Holztrögen, idealerweise aber in einem der zahlreichen Quellwassergranter, von denen es heutzutage in Liefering nur mehr wenige gibt. Frauen ohne Granter in Hausnähe transportierten die Wäsche in Körben auf einem Radlbock hinunter zum Mühlbachl, um dort, auf eigens errichteten Stegen, die Lauge auszuschwemmen und nach kräftigem Auswringen zum Trocknen nach Hause zu bringen. Eine Elendsarbeit - besonders an kalten Wintertagen -, verbunden mit schmerzendem Rücken, klammen, steifen Armen und Händen, von aufgequollenen, rissigen Fingern ganz zu schweigen, meilenweit entfernt von "streichelweich".
Einer dieser Schwemmstege - wo de Wäsch gschwoabbt worn is - ragte vor einem kleinen Waschhäusl in den Lieferinger Mühlbach, nächst der heutigen Unterführung der Fischergasse. Und neben dieser Hütte stand vor längerer Zeit, versteckt und verwachsen durch die das Ufer säumenden Hollerstauden, ein hölzernes Bildstöckl, das an das geheimnisvolle Verschwinden einer unvorsichtigen Bauerndirn erinnerte. Eine Freundin von ihr - sie hieß Leni - hat damals tränenüberströmt behauptet, ein Wassergeist, den sie ziemlich geneckt haben soll, habe sie in den Bach gerissen. Daher warnten Lieferinger Großmütter ihre Enkelinnen eindringlichst mit nachstehendem Moritatengedicht über den tragischen Wassertod der Bauerndirn Babett:
Dort, wo die Hollerbüsch beim Waschhäusl steh'n,
sich unterm Schwemmbrückerl Wasserwirbel dreh'n,
da hockt ein Wassergeist, ein gar böser Wicht
und grinst übers bleiche, grausige G'sicht.
Kommt ihr zu nah', so ist's schon zu spät,
da hilft kein Schrei'n, kein Stoßgebet!
Aber die Dirndln lachen die Bäuerin aus,
holen Wäsche, Seifen und Schaffl heraus
und sind aus der Tür mit einem Husch -
"Was gilt's - wir waschen beim Busch!"
Da ruft die Leni laut lachend: "Ei da daus!
Wir kitzeln den Kerl aus sei'm schleimig'n Haus!"
Und wie planschten da ihre Arme um die Wett',
am vordersten Rand kniet die kecke Babett.
Sie lacht und gurrt: "He, du grausiger Algenbart,
wer krault dir da unten die Wangen so zart?" -
und bückt sich dabei ganz nah' übern Bach,
"Schläfst du - oder bist du überhaupt wach?"
Da - die Leni springt auf - und in wirrem Gemisch,
fliegt alles polternd ins Wasser, zu Frösch und Fisch -
ein gellender Schrei aus angstvollem Mund -
und ein schlitziger Arm reißt Babett auf den Grund.