Die Arbeitswelt ist ungerecht: Eine Verkäuferin in einem Möbelhaus erhält im Monat knapp 1800 Euro brutto, ein Monteur im metallverarbeitenden Bereich kommt auf 2400 Euro. Man stelle sich nun einen Einkaufssamstag vor, an dem gefühlt die halbe Welt aus dem Möbelhaus dringend ein Regal braucht oder zumindest Kerzen. Dann stehen den Massen nicht immer freundlicher Kunden die Angestellten gegenüber, die bereitwillig Auskunft geben, kassieren und beraten, auch wenn der Stress noch so groß und der Ton noch so rau ist. Auch der Monteur im metallverarbeitenden Betrieb arbeitet für sein Geld. Nur sind in seinem Kollektivvertrag finanzielle Entschädigungen vorgesehen, die etwa härtere Arbeitsbedingungen mit sich bringen. Doch vor dem glühenden Hochofen stehen nur noch wenige Metallarbeiter, die Automatisierung hat viele Jobs leichter gemacht. Der psychische und emotionale Stress der Einzelhandelskauffrau, der Pflegekraft und Elementarpädagogin ist nach wie vor so etwas wie "Berufsrisiko".
Warum Dienstleistung so schlecht bezahlt wird
Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Der Nationalökonom und Vater des Liberalismus, Adam Smith, verstand unter produktiver Arbeit, dass aus einem Herstellungsprozess greifbare Waren entstanden. Dienstleistungen gehörten für ihn nicht dazu. Noch heute wird die bessere Bezahlung etwa in der Metallindustrie mit einer höheren Produktivität und dementsprechenden Gewinnen begründet, was sich auf die Löhne auswirkt. Dienstleistungsberufe wiederum haben sich aus der häuslichen Arbeit herausentwickelt. Früher erledigten Frauen unentgeltlich Arbeiten, ohne diese, wie ihnen nachgesagt wurde, aus Liebe zu verrichten: Hausarbeit, kranke Menschen pflegen, das häusliche Umfeld schön gestalten. Daraus entstanden im Lauf des vergangenen Jahrhunderts Jobs wie Reinigungskraft, Pflegerin, Erzieherin, Verkäuferin. Das "richtige" Geld nach Hause gebracht hat immer der Mann. So ist eine Arbeitswelt entstanden, die ihre Ungerechtigkeit schon in den Wurzeln hat, aber dennoch akzeptiert wurde, was noch heute in der DNA vieler Gewerkschafter verankert ist. Eine, in der die Arbeit mit Computer und Maschinen besser bezahlt ist als die mit Menschen.
Junge haben keine Lust auf schlecht bezahlte Jobs
Nun ändert sich der Arbeitsmarkt: Mehr Erwerbstätige gehen in Pension als nachkommen. Die junge Generation hat keine große Lust auf wenig attraktive und schlecht bezahlte Jobs. Eine Angleichung der Lohnniveaus wird nötig sein, vor allem bei jenen Berufen, die in einer Gesellschaft den reibungslosen Ablauf garantieren und die vor zwei Jahren beklatscht wurden, aber noch immer nicht besser bezahlt sind. Diese Berufe sind laut AK-Untersuchung überwiegend weiblich besetzt, körperlich wie psychosozial belastend und erfordern ein großes Maß an Flexibilität, und das mit einer geringeren sozialen Absicherung als in typisch männlichen Berufen. Um es an Beispielen festzumachen, stelle man sich bitte vor, wie sich die Betreuerin in einer Kinderkrippe nach einem Tag Lärm, voller Windeln und fordernder Eltern in ihren Ohrensessel fallen lässt oder die Pflegerin, die den Tod eines demenzkranken Menschen beklagen muss, dem sie zwar in Dauerschleife gepredigt hat, trinken zu müssen, er es aber nicht getan hat.
Zwar gibt es für den Bereich soziale Arbeit seit 2007 einen Kollektivvertrag, psychisch oder emotional herausfordernde Bedingungen sind darin nicht festgeschrieben. Erich Fenninger von der Volkshilfe sieht die Regierung in der Verantwortung, die hier stärker in die Rolle des Fördergebers schlüpfen und Rahmenbedingungen schaffen müsste, um Prestige und Bezahlung dieser Jobs anzuheben. Nachsatz: nicht nur in Sonntagsreden Anerkennung und Applaus spenden, das auch am Montag nicht vergessen, wenn es um die Umsetzung der Versprechungen geht. Er tritt dafür ein, die Löhne und Gehälter in diesen Berufen um etwa 500 Euro anzuheben - als neue und bessere Ausgangsbasis.
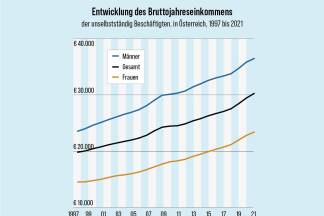
Rochaden in Unternehmen: Mitarbeiter sollen alle Arbeiten verrichten
Für Fenninger hat Lohngerechtigkeit noch eine andere Dimension: Kinder aus armen Haushalten leben nachgewiesenermaßen in Isolation, Unsicherheit und ohne auf ihre Interessen zu achten. Sie "lernen Armut" oft mit dem Ziel, dass sie später Jobs verrichten, die wenig Spaß machen, aber zumindest Geld bringen.
Innerhalb der Berufsgruppen werde es immer Unterschiede geben, betont die Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosy von der Universität Wien. Ein Ansatz zu mehr Gerechtigkeit wäre etwa, Jobs in Unternehmen durchlässiger zu gestalten: Statt den Fokus auf Spezialisierung zu legen, könne man die Tätigkeiten so anlegen, dass Rochaden möglich sind und Mitarbeitende alle Arbeiten verrichten - dazu gehöre freilich auch, die Toiletten zu putzen. Diese Idee entspringt nicht zuletzt aus einer Notwendigkeit: Denkt man über Lohngerechtigkeit nach, gehört die unbezahlte Arbeit berücksichtigt, sagt die Wirtschaftshistorikerin. Haushalts- und Care-Arbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten müssten so verteilt werden, dass alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft sie verrichten, und zwar geschlechterunabhängig. Dass vor allem auch die Männer vermehrt dort anpacken müssen, wo keine Bezahlung winkt.
Kaiserin Maria Theresia schuf Grundlage für Lohnschere zwischen Männern und Frauen
In Österreich legte Kaiserin Maria Theresia den Grundstein für die ungerechte Entlohnung. Sie erlaubte 1751 der Wiener Seidenmanufaktur, Frauen einzustellen, allerdings zu geringeren Löhnen als jenen der Männer. Jahrzehnte später wurde die Ungerechtigkeit kollektivvertraglich einzementiert: Neben den Männerlohngruppen entstanden niedriger dotierte Frauenlohngruppen, die Arbeit war für beide Geschlechter dieselbe. Die Soziologin Vera Glassner von der AK Wien sieht das Kollektivvertragssystem in Österreich dennoch als große Errungenschaft. Sorge bereitet ihr der abnehmende Organisierungsgrad: Die Gewerkschaften haben immer weniger Mitglieder, somit ist auch die "Kampfbereitschaft" geschwächt. Aktuell zeigt sich wieder: Ziviler Ungehorsam, sprich Streik, wirkt oft Wunder. In Deutschland, wo im Jahr 2015 Kita-Betreuerinnen auf die Straße gingen, wurde auf einen Schlag das Dilemma sichtbar, wenn niemand auf die Kleinkinder berufstätiger Eltern aufpasst. Mehr Gehalt für das Personal war die Folge. Für Vera Glassner bestünde die Lösung darin, dass sich die Tarifpartner für mehr Schlagkraft über ihre Interessen hinaus zusammenschließen und die Regierung sich dem Thema Ungerechtigkeit annimmt.
Dazu gehört auch das Dauerbrennerproblem der unentgeltlichen Care-Arbeit.
