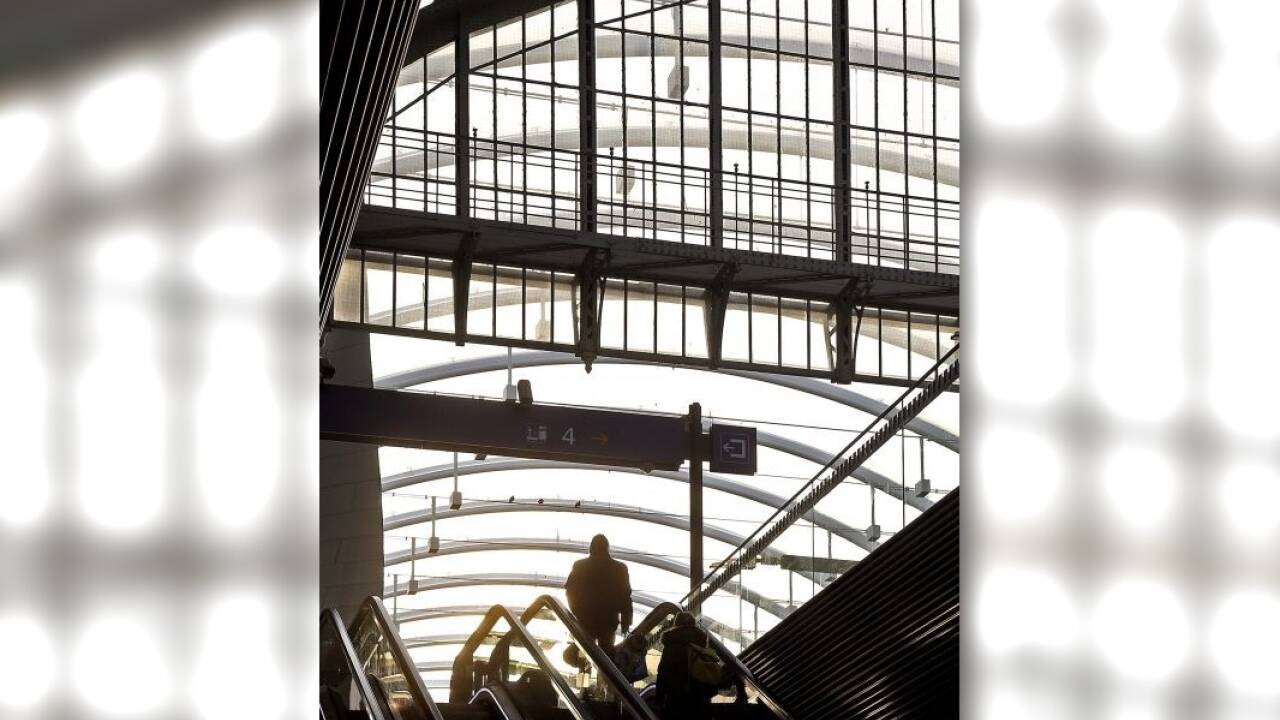Die jungen Reisenden im Zug nach Salzburg haben viel Gesprächsstoff. Doch sie reden nicht über Partys oder Urlaube. In ihre Diskussionen mischen sich Ärger und Verzweiflung: Es ist Mitte des Monats und auf dem Konto sind nicht mal mehr 100 Euro. Kein Einzelfall. Wären nicht Großeltern und Eltern oder bereits verdienende Partner bereit, die finanziellen Löcher auf Pump zu stopfen, wüssten sie nicht mehr, wovon sie ihre Ausgaben bestreiten sollten. Studium und Arbeit sind zudem zeitlich kaum unter einen Hut zu bringen. Einige haben monatelang gesucht, um in Salzburg wenigstens ein Zimmer in einer WG zu finden. "15 Quadratmeter für mehr als 600 Euro", sagt eine Studentin. Von einer bezahlbaren Mietwohnung träumt niemand. Beim Caffè Latte in einem Kaffeehaus sitzen und arbeiten? Der kostet mittlerweile fast überall zwischen fünf und sechs Euro, exklusive Trinkgeld. "Die Preise in Salzburg sind insane", sagen sie.
Szenenwechsel: Auf dem abendlichen Weg vom Bahnhof in die Innenstadt fährt der Bus an dunklen Höhlen vorbei. In den vergangenen Monaten haben etliche Geschäftsleute aufgegeben. Größer wird dafür der Anteil an Luxusketten, Pop-up-Stores, Kurzzeit-Galerien, Souvenirshops, Essbuden oder an verschmutzten und verklebten Scheiben und Vitrinen, die irgendetwas bewerben.
Die Salzburger Impressionen sind auch anderswo zu finden: In Deutschland hat jeder zweite Mieter Angst, dass er die Miete bald nicht mehr bezahlen kann. In manchen Gemeinden gibt es Überlegungen, Supermärkte mit bezahlbaren Wohnungen zu überbauen. In Zürich bewarben sich 14.000 Menschen um 193 Wohnungen, die die Stadt günstiger vermietet als der Markt, wie die "NZZ am Sonntag" berichtete. In ganz Europa ringt der stationäre Handel mit Online-Anbietern. Einzelhändler in den Zentren müssen finanziell potenteren Luxusmarken weichen, sogar in wohlhabenden Städten wie München oder Zürich. Eine unflexible Bürokratie erschwert Kleinunternehmern Initiativen. In mittelgroßen deutschen Städten versuchen Wirtschaftsverbände Kunden mit Events, Rabattschlachten und Gutscheinen in die zunehmende Ödnis zu locken. Kunsthandwerker sind aufgerufen, Leerflächen temporär zu bespielen. In einer halbtoten Stadt will niemand bummeln gehen. Jede betroffene Stadt versucht Antworten zu finden.
Die Stadtzentren leeren sich
In Zürich sitzt Vittorio Magnago Lampugnani in seinem Planungsbüro und nickt. Er ist Architekt, Stadtplaner und international renommierter Fachmann für Stadtgeschichte mit Lehraufträgen in Harvard, Zürich und Mailand: "Wir stellen in vielen unserer Planungen fest, dass sich die Stadtzentren leeren, ausgenommen im Tourismus. Dieser ersetzt die feste, ansässige Kundschaft. Die hohen Preise im Wohnbereich und in der Gastronomie, die auch noch an Qualität verliert, vertreiben die Stadtbewohner. Etliche ziehen weg, weil es keine Läden für den täglichen Gebrauch gibt, sondern nur noch Bars. Und Airbnb-Wohnungen. Dass sich zudem viel Konsum in das Internet verlagert hat, ist ein - bedauerliches - Faktum."
Rezepte gibt es nicht. "Das Meiste ist nur kurzfristige Kosmetik", sagt Lampugnani, "es hilft alles nichts, wenn es nicht gelingt, die soziale Dichte zu schaffen. Man muss sich Quartiere anschauen, die gut funktionieren. Es braucht in einem Radius von 500 Metern 10.000 Menschen, die dort wohnen und 5000, die dort arbeiten. Menschen machen eine Stadt lebendig. Und dafür sind die Preise entscheidend. Hohe Marktwerte und Mieten ziehen nur Leute an, die sich einkaufen, um zu investieren. Die Preise müssen so sein, dass ein normal verdienender Mensch oder eine Familie sich das Wohnen in der Stadt leisten kann."
Gelänge es, die die Stadtzentren zum Lebensraum zu machen mit der Dichte, mit der sie einst geplant waren, dann würden auch die Läden, der Mix und das Flair zurückkehren. Unter der Bedingung, dass diese Läden Qualität bieten: "Eine Buchhandlung wird sich in der Stadt nicht halten, wenn es keine Beratung gibt."
Fazit des Stadtplaners: Bewohner eignen sich eine Stadt auf ihre Weise an, aber die Politik muss steuern und eingreifen. Als ein gelungenes Beispiel führt Vittorio Magnago Lampugnani Wien an. "Dort hat man schon in der Zwischenkriegszeit mit einer überlegten und sozialen Wohnungspolitik begonnen. Es gab auch Talente, die die Stadtökonomie durchschauten. Und es gab und gibt Leute, die für die Stadtplanung Rückhalt und den notwendigen langen Atem hatten und haben. Man macht sich damit ja nicht nur Freunde. Neben der Preisgestaltung ist die Stadtplanung das Wichtigste."
Man muss "gemeinschaftlich denken"
Diese sei allerdings schwieriger geworden. Man wolle oder könne die Freiheit eines Einzelnen nicht antasten, weil das reflexartig Stürme der Entrüstung auslöse. "Wenn man aber in einer Gemeinschaft leben will, muss man gemeinschaftlich denken. Häuser in der Stadt bilden die öffentlichen Räume mit Höhe und Breite, mit Stilelementen und Fassaden, darüber hinaus braucht man Plätze, Durchgänge, Innenhöfe, Sichtachsen, Blickfänge. Dafür muss es Regeln geben. In allen guten Städten, dort, wo alle gern leben wollen, wurde zuerst der öffentliche Raum definiert und dann gebaut. Das Paris, das im 19. Jahrhundert entstand, ist ein markantes Beispiel dafür", sagt Lampugnani.
Wie schaut der Plan in Salzburg aus? Dafür ist derzeit Anna Schiester (Bürgerliste) zuständig: "Es gibt keinen Masterplan, aber wir arbeiten an ineinander greifenden Strategien, in die auch die Umlandgemeinden eingebunden sind. Die Stadt kann festlegen, wo Wohnraum entsteht und wie dicht gebaut wird. Auch die Flächenwidmung erfolgt über die Stadt - neue Flächen werden nur noch als ,förderbar' gewidmet, mit einem hohen Anteil geförderter Mietwohnungen. Die Stadt kann zudem für Bebauungspläne Anreize setzen und Ziele vertraglich festlegen. Salzburg hat nur begrenzt Platz, daher müssen wir Flächen klug nutzen, verträglich nachverdichten und den Bestand nutzen, der auf versiegelten Flächen bereits vorhanden ist", sagt sie.
Salzburg kaufe keine Immobilien, um sie günstiger zu vermieten, sondern Grundstücke. Die Stadt könne solche Grundstücke bevorzugt für leistbaren Wohnraum nutzen. "Die Widmung ist eines der stärksten Steuerungsinstrumente, das wir haben. Ich nenne ein Beispiel: Bestehende Liegenschaften wie jene in der Michael-Pacher-Straße müssen gezielt für geförderten Wohnraum verwendet werden. Der AVA-Hof wäre ein möglicher Wohnraum gewesen. Die Bewilligung für die Hotelnutzung stammt leider aus der Zeit vor meiner Ressortführung", stellt Anna Schiester fest.
Wohnen, arbeiten und die Gemeinschaft pflegen
Damit Familien in der Stadt bleiben, braucht es nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern Kinderbetreuung, begrünte und freie Flächen sowie Projekte, die Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaftsleben verbinden.
Ein solches Vorhaben ließe sich in Schallmoos verwirklichen (siehe verlinktes Interview unten). Die Idee, Schallmoos mit seinen bereits bestehenden Stärken zu einem lebendigen Stadtteil mit Wohnraum, Gewerbe und Kultur weiter zu entwickeln, sei realistisch, sagt Schiester: "Noch vor dem Sommer werden wir einen Stadtteilentwicklungsprozess unter Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern und der Grundeigentümer starten. Ziel soll ein Masterplan sein, der den unterschiedlichen Interessen gerecht wird." Die Umgestaltung von Schallmoos erfordere allerdings Investitionen für Infrastruktur, Umwidmungen oder Sanierungen.
Vielfalt und Flexibilität sind Stichworte für Marco Salvi, Ökonom beim Schweizer Thinktank "Avenir Suisse": "Man muss für jede Stadt berücksichtigen, was sie kann. Trends hinterherzuhecheln hilft nicht. Was für Zürich stimmt, muss nicht für Salzburg passen. Es kann helfen, über Widmungen nachzudenken und dafür die Märkte und die Preissignale zu beachten. Das betrifft eine der wichtigsten Aufgaben der Raumplanung: die Festlegung von Wohn- und Arbeitszonen", sagt er.
In vielen Städten gebe es ein Überangebot an Gewerbe- und Büroflächen mit geringeren Erträgen. Mieten dort seien weniger stark gestiegen als die Wohnungsmieten. Auch die Bodenpreise seien je nach Nutzung unterschiedlich. Bei der Anpassung von Bauzonen sollte Raumplanung deshalb darauf achten, dass für Bauland unabhängig von der Nutzung ähnliche Preise erzielt würden.
"Das andere ist die Umwidmung von Büroflächen in Wohnraum. Das müsste man für die Eigentümer attraktiver machen, denn die haben Angst, dass sie nicht mehr zurückwechseln können. Flexibilität ist auch beim Verdichten gefragt, mit dem wir uns hier bei Avenir Suisse aus ökologischen Gründen viel beschäftigen. Bei dem Wort zucken viele zusammen und denken an gesichtslose Hochhäuser. Das muss aber nicht sein. Ich denke an eine langfristige Erneuerung des Baubestandes. In Zürich werden so etwa rund um den See Einfamilienhäuser in Mehrfamilienhäuser umgewandelt. Für Umlandgemeinden und Speckgürtel wäre das ebenfalls eine Möglichkeit. Das ist eine sanfte Verdichtung, keine spektakuläre, sie zahlt sich aber in der Summe aus", sagt Marco Salvi.
Orte, wo man kein Geld braucht
Reparieren, umbauen, weiterbauen: das sind auch die Ansätze von Vittorio Magnago Lampugnani: "Die weltweite Bauwirtschaft ist verantwortlich für 30 Prozent der CO₂-Emissionen, für 40 Prozent des Energieverbrauchs, für 60 Prozent des Abfallaufkommens und 70 Prozent des Flächenverbrauchs. Je länger ein Gebäude lebt, desto ökologischer ist es. Und nur eine kompakte Stadt kann ökologisch sein."
Stadtplaner werden auch gezwungen sein, umzudenken, wenn das alte Erfolgsmodell Dauerkonsum bröckelt. Was Menschen jeden Alters schon seit langem am meisten vermissen, wenn man sie zu ihrer Stadt befragt, sind Orte, an denen sie sein können, ohne Geld ausgeben zu müssen. In manchen deutschen Kommunen wurden für den Konsumzwang in den vergangenen Jahren sogar Parkbänke abmontiert. Wer gemütlich sitzt, kauft nicht.
Einen anderen Weg hat etwa Basel eingeschlagen. Dort ist das "Unternehmen Mitte" erfolgreich. Das Kaffeehaus gehört einer gemeinnützigen Stiftung. Niemand muss hier kaufen oder darf nur gegen Speis' und Trank sitzen und sich mit anderen unterhalten. Das "Unternehmen Mitte" ist - wie es schön gestaltete Plätze oder Parkanlagen sein können - ein öffentliches Wohnzimmer. Die Stadterbauer der Vergangenheit haben das verstanden.
Von Vittorio Magnago Lampugnani ist zuletzt das Buch "Gegen Wegwerfarchitektur. Weniger, dichter, dauerhafter bauen" im Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2023, erschienen.