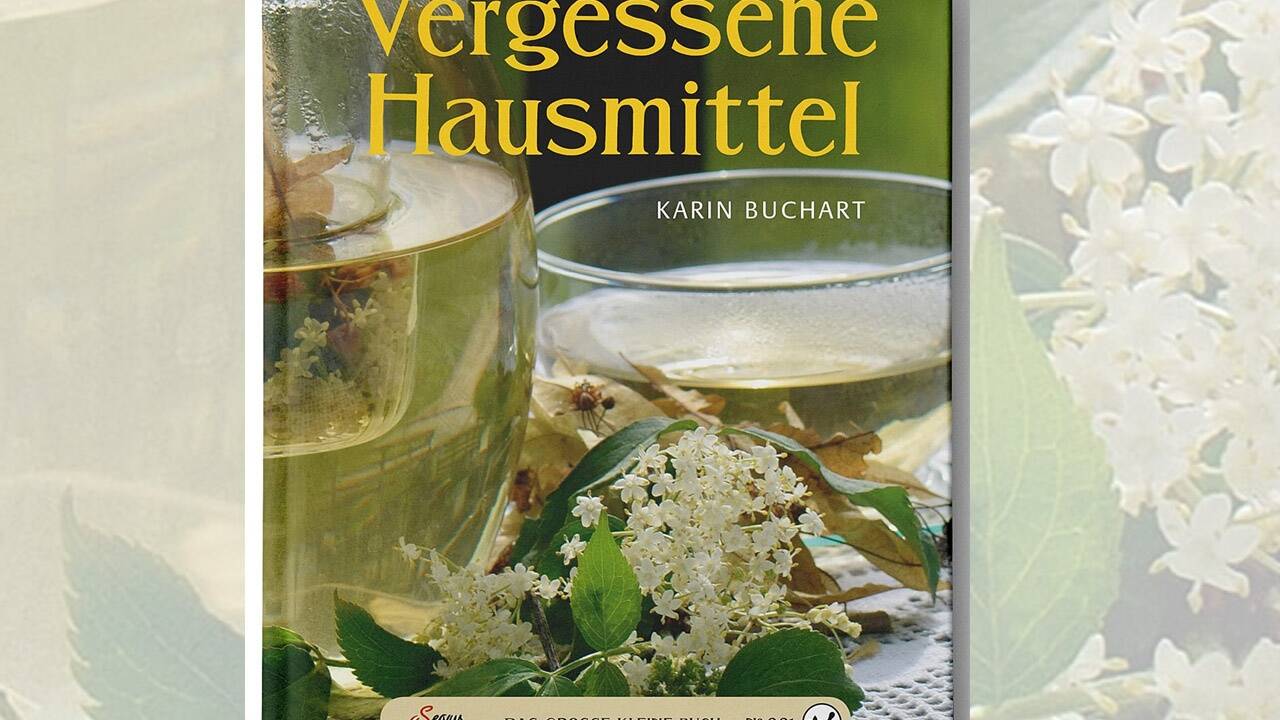1. Fermentierte Kräuterlimonade bringt probiotische Bakterien mit

Der Hollersprudel ist eine meiner Lieblingszubereitungen: lebendig, spritzig und rar, weil es ihn nur zur Hollerblüte gibt. Inzwischen sind genau diese lebendigen Getränke hoch im Kurs. Alles wird kreuz und quer vergoren oder zumindest angegoren, beobachtet, daran gerochen und verkostet. Nur: Heutzutage nennt man es nicht mehr vergären, sondern fermentieren. Man studiert auf der Boku ja auch nicht mehr Gärungstechnik, sondern Biotechnologie.
Wer einige fermentierte Getränke selbst hergestellt hat, kommt langsam hinter das Prinzip des Vergärens. Es geht immer darum, die Bedingungen für jene Mikroben zu optimieren, die vermehrt werden sollen. Deshalb kann man nach dem Vorbild "Hollersprudel" verschiedene Sprudel herstellen. Fehlgärungen riechen unangenehm und vermissen dieses wundervolle fein-säuerliche Aroma. Immer brauchen wir dazu Wasser, Kräuter und/oder Früchte, etwas Saures und Zucker. Zitronensaft und Essig machen die Limonade gleich zu Beginn leicht sauer, das gefällt den guten Milchsäurebakterien und sie vermehren sich. Auch brauchen sie etwas zu essen - das ist der Zucker. Daraus gewinnen sie ihre Energie und scheiden wieder Säuren aus. Mit Kräutern und Früchten liefern wir zusätzliche Pflanzenwirkstoffe zum Knabbern für die Mikroorganismen. Sie zerlegen diese, wie etwa die Gerbstoffe. Es werden leichtere, flüchtige Aromen freigesetzt und das Getränk beginnt zu duften und bekommt Geschmack. Der Sprudel schmeckt nicht nur gut, er prickelt auch ein wenig und vor allem bringt er probiotische Bakterien mit. Er säuert die Schleimhaut an, sodass sich wertvolle Mikroben dort richtig wohlfühlen.
Für so einen Sprudel kann man in 3 Litern Wasser 150 g Zucker, 1 Zitrone in Scheiben, 1/16 Liter Essig, einige Erdbeeren, oder noch besser Walderdbeeren, eine Holunderblüte und Rosenblüten ansetzen. Nur mit einem Tuch zugedeckt, dauert es knapp zwei Tage, bis der Sprudel seinen typischen feinsäuerlichen Geschmack entwickelt hat. Wiederholtes Riechen und Verkosten lässt erkennen, wann er fertig ist. Danach abseihen, in den Kühlschrank stellen und bald trinken.
2. Krampfkraut gegen Menstruationsbeschwerden

Jeden Monat wieder tut sich einiges im Körper einer Frau. Es ist ein ziemlicher Kraftakt, die Gebärmutterschleimhaut loszulösen. Deshalb ist dieser Vorgang bei vielen auch mit krampfartigen Schmerzen und anderen Nebenwirkungen verbunden.
Eine Kräutermischung, die die Tage vor und zu Beginn der Menstruation erleichtert, ist das Krampfkraut. Gemeint ist das Gänsefingerkraut, dessen Blätter silbrig leuchten, wenn der Wind sie umdreht. Es löst die schmerzhaften Krämpfe im Unterleib. Warum es so gut entspannt, wissen die Experten noch nicht genau.
Das Gänsefingerkraut blüht leuchtend gelb und so ernten wir es auch. Gänsefingerkraut harmoniert gut mit Frauenmantel und Schafgarbe - auch da verwenden wir ebenfalls das blühende Kraut. Alle drei Heilpflanzen fördern die Entspannung und Durchblutung der Gebärmutter und leiten die zweite Hälfte des weiblichen Zyklus ein. Sie wirken ausgleichend auf den Hormonhaushalt und empfehlen sich deshalb auch für die Phase der Wechseljahre.
Oft wird der Monatstee mit Kamillenblüten ergänzt. Das entzündungshemmende und beruhigende Kraut verstärkt die Wirkung. Kamille hebt zusätzlich noch die Stimmung. Wer Kamille mag, kann sie auf alle Fälle hinzufügen.
Gänsefingerkraut, Frauenmantel, Schafgarbe und Kamille können für den Monatstee frisch oder getrocknet zu gleichen Teilen gemischt werden - heiß aufgießen und zugedeckt sieben Minuten ziehen lassen. Am besten ist es schon zwei bis drei Tage vor der Menstruation mit dem Tee zu beginnen.
Das Ritual und die Ruhe der Teezubereitung und des Teetrinkens haben einen Wert für sich. Hinzu kommt die Tasse warmes Wasser, die jede Tasse Tee mitbringt!
3. Hellgrüne Fichtenwipfel bestechen als Entzündungshemmer
Kleine, hellgrüne Tupfen sind in diesen Tagen und Wochen überall im Wald verstreut, bringen Farbe in die Landschaft und erfreuen unser Auge.
Es sind die Wipfel der Fichten, die jetzt austreiben. Damit ihre "Kleinen" gut über die Runden kommen, sind sie zuerst in viel Harz gebettet. Sie stecken am Anfang noch in den Resten der hellbraunen Hülle. In diesem Zustand schmecken sie bitterherb und recht sauer. Im Anschluss wachsen sie etwas in die Länge, werden buschiger und nehmen sich im Geschmack zurück.
In der Volksmedizin gibt es verschiedene Methoden, um die sperrigen Gerbstoffe und Harze aus den Sprenglingen zu lösen und ihre Wirkung zu entfalten. Entweder sie werden lange gekocht - wie im Wipfelsirup - oder einige Monate mit Kandiszucker fermentiert.
Eine schnellere Methode, weil in der heutigen Zeit ja alles schneller gehen soll, ist die Mischung mit Honig und Zitrone. Eine Handvoll der jungen, noch hellgrünen Triebe - etwa 50 Gramm - werden dafür mit der gleichen Menge Zitrone (das ist ungefähr eine halbe), und mit 150 Gramm Honig gemixt. Eventuell darf noch eine Prise Galgant hinein, um dem Aufstrich eine ganz leichte Schärfe zu geben.
Daraus entsteht ein Mus mit einer so wundervollen hellgrünen Farbe, alleine aufgrund derer ist es das Mus schon wert, es auszuprobieren. Da ich nicht genau weiß, wie lange der Aufstrich haltbar ist, würde ich nur so eine kleine Menge davon herstellen.
Dieser "Wipfelhonig" passt perfekt auf das Butterbrot. Manche unter Ihnen werden sich jetzt fragen, ob wirklich auch schon das Frühstück grün sein muss. Muss es nicht, kann es aber!
Der Maiwipfelhonig bringt Harze ins Essen und diese haben innerlich eine ähnliche Wirkung wie eine Pechsalbe: Sie hemmen Entzündungen und wirken gegen ungünstige Mikroorganismen. Zudem gibt es diesen besonderen "Maiwipfelhonig" nur jetzt und danach kann man sich wieder ein ganzes Jahr darauf freuen!
4. Petersilie hilft dabei unerwünschte Bakterien auszuschwemmen

Nicht jeder mag viel Grünzeug auf dem Essen, doch die Tendenz ist steigend. Ein unbeachtetes Pflänzchen, das wirklich viel Grünes mitbringt, ist die Petersilie. Früher war sie neben dem Schnittlauch das wichtigste Kraut am Esstisch, heute geht sie in der Fülle der Kräuter manchmal fast unter.
Petersilie hat enorm viel Grünkraft in sich und wird beim Chlorophyllgehalt nur von der Brennnessel und vom Grünkohl übertrumpft. Und die Petersilie führt zur Vollendung vieler Gerichte. Oft nur in kleinen Mengen - aber beständig anwesend.
Petersilie ist bekannt dafür, die Entwässerung zu fördern und zu beschleunigen. Ihre Blätter und Wurzeln helfen mit, die Harnwege durchzuspülen und unerwünschte Bakterien mit auszuschwemmen. Dieses Entwässern hilft auch, den Blutdruck in einem guten Bereich zu halten. Ebenso soll Petersilie das Herz stärken, auch weil es eine ganze Menge Vitamin K mitbringt. Zum Tragen kommt das besonders in Pestos, wenn die Menge, die man isst, etwa einer Handvoll Petersilienblätter entspricht. Tomatensalate vertragen auch sehr viel Petersilie - in manchen Gegenden gleich viel Petersilie wie Tomaten. Die Petersilie lässt das Blut so beschwingt fließen, dass sie sogar bei blutverdünnenden Medikamenten beachtet werden muss.
Wenn sie bald im Garten zu wuchern beginnt, wird es Zeit für das Petersilienpesto. Dafür können ungefähr 100 g Petersilie mit 70 g Walnüssen, 100 g Parmesan, etwas Knoblauch, Salz, Paprika, Zitronensaft, Zitronenschale und einem Achtelliter Olivenöl in der Küchenmaschine gemixt werden. Wer Koriandergrün mag, das vor allem durch asiatische Gerichte zu uns gekommen ist, kann das Pesto damit variieren oder ergänzen. So ein grüner Mix macht die gesunde Petersilie zur Köstlichkeit, die auf vielen Speisen Akzente setzt.
5. Heidelbeeren in der Hausapotheke gegen Verstopfung und Durchfall

Tiefviolett und süß, so sollen sie sein. Nicht blass und wässrig. Die Heidelbeeren. Sie sind ein wenig sonnenscheu, dennoch mögen sie die frische Waldwärme im Sommer. Überall gibt es die geheimnisvollen Plätze, wo sie so dicht wachsen, dass man sie scharenweise abstreifen kann.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass getrocknete Heidelbeeren in der Hausapotheke waren. Vielerorts kennt man das aber noch. Die frischen Heidelbeeren bringen den Darm in Bewegung und wirken gegen Verstopfung. Die getrockneten haben genau die gegenteilige Wirkung: Sie bremsen den Durchfall! Und weil dieses Mittel auch für Kinder gut geeignet ist, waren die haltbaren Beeren ein gutes Hausmittel für solche Zwischenfälle. Solche gab es früher viele, landläufig wurden sie Dusel genannt.
Eine getrocknete Beere auf die Zunge gelegt verrät schon, was da los ist. Es fühlt sich zusammenziehend und trocken an. Die Gerbstoffe der Heidelbeere gerben tatsächlich die obersten Eiweiße der Schleimhaut und machen sie unempfindlich. Bakterien können sich so nicht mehr halten und zudem wird ihnen das Wasser entzogen. Sie verabschieden sich und der Durchfall lässt nach.
Die getrockneten Heidelbeeren werden mit kochendem Wasser übergossen und ungefähr 15 Minuten ausgezogen:
Für Kinder im ersten Lebensjahr 1 gehäuften TL getrocknete Heidelbeeren, im Kindergartenalter 2 TL, in der Volksschule 3 TL und danach 4 TL mit 0,2 Liter kaltem Wasser aufkochen und zehn bis 15 Minuten köcheln, um die Gerbstoffe zu lösen. Der Heidelbeertee wirkt sanft und gleichzeitig effektiv gegen Durchfall und er schmeckt sogar ganz gut!
6. Leuchtend gelbes Johanniskraut für das Gemüt

Das Johanniskraut leuchtet uns jetzt beim Wandern oft entgegen. Bei uns zu Hause wächst es heuer im Garten besonders gut. Wer sich nicht sicher ist, welche der gelben Pflanzen das Johanniskraut ist, zerquetscht einfach Knospen oder Blüten zwischen den Fingern. Das bringt nämlich einen inneren Wert ans Tageslicht: die tiefrote Farbe.
Das rote Hypericin ist einer der beiden Hauptwirkstoffe im Johanniskraut. Wir können es gut mit Olivenöl ausziehen oder mit Schnaps, der löst es noch schneller aus der Pflanze.
Das Johanniskraut ist immer mit Licht in Verbindung. Seine Pflanzenwirkstoffe reagieren und verändern sich schnell im Licht. In unserem Körper kümmert sich das Johanniskraut darum, schneller und mehr Licht hereinzulassen. Das könnte im Sommer sogar einen Sonnenbrand bewirken, meinen manche, doch mit dem natürlichen Kraut als Tee oder Tinktur erreichen wir diese ungünstige Wirkung nicht.
Natürlich können wir uns das Johanniskraut in der Apotheke kaufen. Dennoch ist es einen Versuch wert, es selbst zu sammeln. Handverlesen von den Salzburger Almen und im Schatten bei weniger als 40 Grad Celsius getrocknet, sehen wir schon rein optisch, wie gesund und kraftvoll der Tee wird. Wenn dann im Herbst die Tage kurz werden und das Licht einen grauen Schatten bekommt, wird es Zeit für einen Johanniskrautaufguss. Dafür werden ein Teelöffel Blüten und Knospen mit einem halben Liter heißem Wasser übergossen und nur wenige Minuten ausgezogen.
Der Johanniskrauttee ist ein sanfter Auszug aus der Heilpflanze, der die Stimmung erhellt, zur Ruhe kommen lässt und sogar ein wenig angstlösend wirkt. Um die Wirkung zu spüren, braucht es Zeit für die Anwendung, der Tee kann ruhig im November und Dezember über mehrere Wochen getrunken werden.
7. Apfelsaft-Tonikum - Naturdoping der ersten Stunde

Wir sind schon mitten in der Apfel-Zeit angekommen. Apfelsaft ist mein Lieblingsgetränk. Aber nicht nur meines: Apfelsaft ist überall präsent und wird auch von vielen noch selbst gepresst. Zumindest ist Apfelsaft aus Salzburg erhältlich, wenn man sich ein wenig umschaut.
Obwohl die Franzosen hauptsächlich Wein trinken, hat Maurice Messèguè auch viel über Äpfel geschrieben. Er war ein berühmter Heilkundiger in den Nachkriegsjahren.
Einmal bekam er den Auftrag, ein erfrischendes Getränk aus Wasser und Kräutern zu entwickeln, das die Radfahrer der Tour de France aktivieren sollte. Messèguè erfand sein Vitalitätstonikum. Das ist ein Naturdoping der ersten Stunde. Dafür empfahl er, einen Kräuterbuschen aus je einem Stängel Lavendel, Pfefferminze, Rosmarin und Thymian und sechs Stängel Bohnenkraut in einen Liter Apfelsaft zu hängen. Dieser sollte für 2 Stunden in die Sonne gestellt werden, um den Auszug zu intensivieren. Danach wurden die Kräuter entfernt und der Apfelsaft mit Wasser verdünnt getrunken.
Tatsächlich gilt gespritzter Apfelsaft auch heute noch als gutes Elektrolytgetränk. Das Mineralstoffspektrum kann mit einer Prise Salz und magnesiumreichem Wasser (mehr als 50 mg Magnesium pro Liter) noch optimiert werden. Mit dem Schweiß geht viel Natrium verloren und Magnesium ist oft ein wenig knapp. Die Mineralstoffe werden aus dem natürlichen Saft besser in den Körper aufgenommen als aus künstlichen Mischungen. Die zugesetzten Kräuter aktivieren zusätzlich. Bohnenkraut, Rosmarin und Lavendel geben dem Getränk einen leichten bitteren Anstoß, der sich muntermachend anfühlt. Wobei Lavendel stets eine Balance zwischen Aktivierung und Entspannung herstellt. Minze erfrischt, Thymian entspannt die Bronchien und erleichtert das tiefe Durchatmen. Der Kraftschub soll nach Messèguè körperlich und psychisch spürbar sein. Grund genug, das Vitalitätstonikum einmal auszuprobieren!
8. Schinkenwurz

Ich habe Schinkenwurz als Überschrift genommen, dann lesen vielleicht auch einige Männer die Kolumne. Denn diese Wurzel ist wirklich teilweise so hellrosa wie gekochter Schinken. Das ist aber auch schon das Einzige, was die Wurzel der Nachtkerze und der Schinken gemeinsam haben.
Die meisten von uns haben sie schon gesehen, doch oft nicht ganz bewusst wahrgenommen. Die wunderschöne, hellgelbe Blüte der Nachtkerze öffnet sich im Sommer meistens zwischen 20 und 21 Uhr. Das macht sie in einer Geschwindigkeit, dass das Zuschauen Freude bereitet. In den Morgenstunden schließt sie ihre Blüten wieder und lässt sie abfallen.
Viel bekannter als die ganze wilde Pflanze ist das Nachtkerzenöl, das die begehrte Gamma-Linolensäure enthält. Diese spezielle Fettsäure hilft vor allem jenen, deren Fettstoffwechsel nicht ganz rund läuft. Oft zeigen sich bei Menschen mit sehr trockener und schuppiger Haut Besserungen, wenn sie einen halben Teelöffel Gamma-Linolensäure am Tag einnehmen.
Doch zurück zur Wurzel. Die Nachtkerze ist zweijährig und bildet im ersten Jahr eine Rosette, die ab jetzt bis ins Frühjahr geerntet werden kann. Auseinander geschnitten, zeigt sie ihre rötliche Färbung. Doch viel nachdrücklicher als die Farbe ist ihr Eindruck auf der Zunge. Die rohe Nachtkerzenwurzel hinterlässt einen derartig abrupt bitterherben Geschmackseindruck, der sich kaum beschreiben lässt. Und der ist so richtig nachhaltig und erinnert noch Stunden danach an die Schinkenwurz. Besser ist, die Wurzel in Scheiben zu schneiden, in Zitronenwasser zu tauchen, um ihre helle Farbe zu bewahren, und bissfest zu kochen. Mit etwas zerlassener Butter oder als Salat schmeckt sie dann vorzüglich. Obwohl sich stets alles um das Öl der Nachtkerze dreht, stecken dennoch auch eine ganze Menge gesundheitsfördernder Pflanzenwirkstoffe in der Wurzel. Und wer schon einmal ein winziges Stück dieser rohen Wurzel gekostet hat, kann sich das auch gut vorstellen!
Info:
Karin Buchart ist Kräuter- und Heilpflanzenexpertin & Ernährungswissenschafterin
www.buchart.at