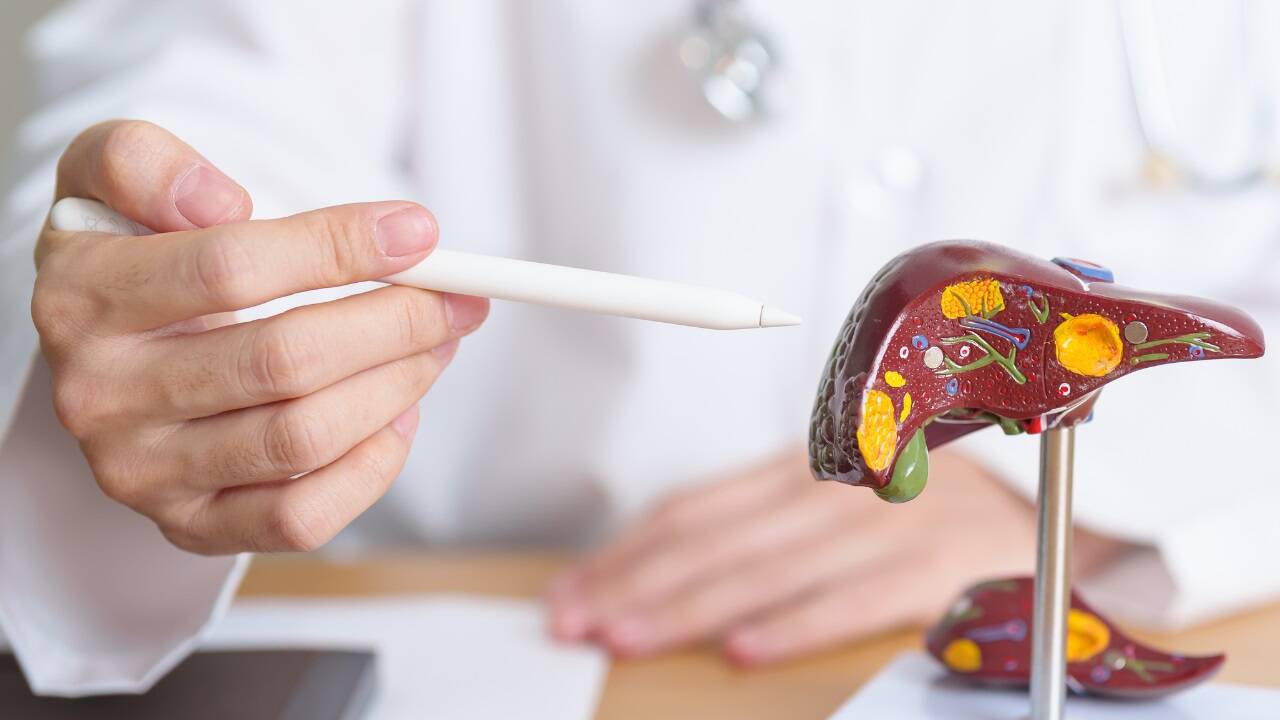Dumpfe Schmerzen im Oberbauch, Appetitlosigkeit und Fieber - für Peter F. wurden diese Symptome an manchen Tagen unerträglich. "Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll", erinnert er sich daran. "Am schlimmsten war es zu Ostern, weil ich das schwere Essen nicht vertragen habe." Erst eine Untersuchung brachte Gewissheit und die Diagnose: Peter hatte einen großen Gallenstein, der die Gallenblase lahmlegte und den Gallengang blockierte. Bei mehr als 30.000 Österreicherinnen und Österreichern werden Gallensteine und Gallenblasenentzündungen jährlich diagnostiziert.
Leben mit Gallensteinen
Rund 30 Prozent der Bevölkerung machen Gallensteine zu schaffen, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. "Die meisten Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen, sind über 40 Jahre alt und ernähren sich oft fett- und kalorienreich", erklärt Martin Schindl, Facharzt für Chirurgie in Wien. "Oft werden die Steine erst entdeckt, wenn sie Beschwerden auslösen."
Die Gallenblase hat eine Länge von bis zu zwölf Zentimetern und eine Breite von bis zu acht Zentimetern. Die Gallenflüssigkeit, die in der Leber produziert wird, fließt in diese Blase hinein - bis zu ein halber Liter pro Tag. Sie wird auf dem Weg durch den Hauptgallengang in Richtung Verdauungstrakt zwischengespeichert, um sie bei Bedarf zur Unterstützung der Verdauung an den Zwölffingerdarm abzugeben. Die Aufgabe der Gallenflüssigkeit besteht darin, an der Verdauung der Nahrung mitzuwirken sowie Stoffwechselprodukte aus der Leber abzutransportieren.
Nur wenn Beschwerden auftreten, werden die Gallenblase sowie die umliegenden Organe untersucht, sagt Facharzt Michael Häfner, "um Gewissheit zu haben". "Nur ein Stein ist noch kein Grund für eine Operation", fügt der Gastroenterologe hinzu. Befinden sich aber Steine im Gallengang, können sie ihn verstopfen und die bekannten krampfartigen Beschwerden hervorrufen, die auch zu einer nicht ungefährlichen Entzündung der Gallenwege, einer sogenannten Cholangitis, führen können. Andauernde Schmerzen im Oberbauch, Fieber und Schüttelfrost sind deren häufigste Symptome. Gallensteine können mit oder ohne Beschwerden vorkommen: Während bei asymptomatischen Gallensteinen nicht unbedingt operiert werden muss, sollten Gallensteine, die Schmerzen bereiten, entfernt werden.
Gallensteine bilden durch Ernährung
Gallensteine können manchmal eine Größe von bis zu einem Zentimeter erreichen. Doch woraus setzen sie sich zusammen? Bei über 80 Prozent der Betroffenen bestehen sie aus Cholesterin, was Expertinnen und Experten vor allem auf die Ernährung zurückführen. Durch eine Übersättigung der Gallenflüssigkeit können sie sich nicht mehr auflösen und lagern sich darin ab. Sind die Steine nur drei Millimeter groß, werden sie als Gallensand bezeichnet. Um Gallenblasensteine (Cholezystolithiasis) in der Gallenblase und im Gallengang zu diagnostizieren, ist eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) notwendig. Denn diese liefert immer sehr präzise und verlässliche Ergebnisse. Stecken die Steine im Gallengang, bieten sich Magnetresonanztomografie oder Endosonografie an, die in den allermeisten Fällen zur Diagnose führen. Mittels einer Magenspiegelung können andere Ursachen wie etwa eine Gastritis ausgeschlossen werden. Dabei führt der Arzt einen Schlauch über die Speiseröhre in den Oberbauch. Für Peter kam die Diagnose überraschend. "Ich war davon überzeugt, dass es nur über 60-Jährige bekommen", erinnert sich der 47-Jährige, "jedoch nicht ich."
Komplikationen bei OP sind selten
Da bei Peter die Beschwerden nicht aufhörten, war eine Operation der Gallenblase unvermeidlich. Sein Facharzt überwies ihn an ein Krankenhaus. Die Entfernung dauerte rund 45 Minuten und wurde in Vollnarkose durchgeführt. Dabei setzten die Chirurgen die minimalinvasive Methode (laparoskopische Cholezystektomie) ein, die auch als Schlüssellochtechnik bezeichnet wird. Über den einen Schnitt wird eine Kamera eingeführt; über die anderen wird operiert. Zusätzlich wird ein Luftgemisch in den Bauchraum geblasen, damit der Chirurg oder die Chirurgin leichter operieren kann. Solche Eingriffe hinterlassen kaum Narben. Komplikationen treten bei Gallenblasenoperationen nur sehr selten auf, beruhigt Martin Schindl.
In manchen Spitälern wie etwa am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien wird die Gallenblase auch tagesklinisch operiert. Nach dem Eingriff am Vormittag können die Patientinnen und Patienten das Krankenhaus bereits am Nachmittag wieder verlassen. Seit dem Jahr 2014 wurden dort bereits über 500 Gallenblasen tagesklinisch entfernt. Doch nicht immer sei das möglich, schränkt das Krankenhaus ein. "Einen stationären Aufenthalt benötigen Menschen nicht nur mit anderen Krankheiten, sondern auch allein lebende Personen, für die An- und Abreise zu anstrengend ist."