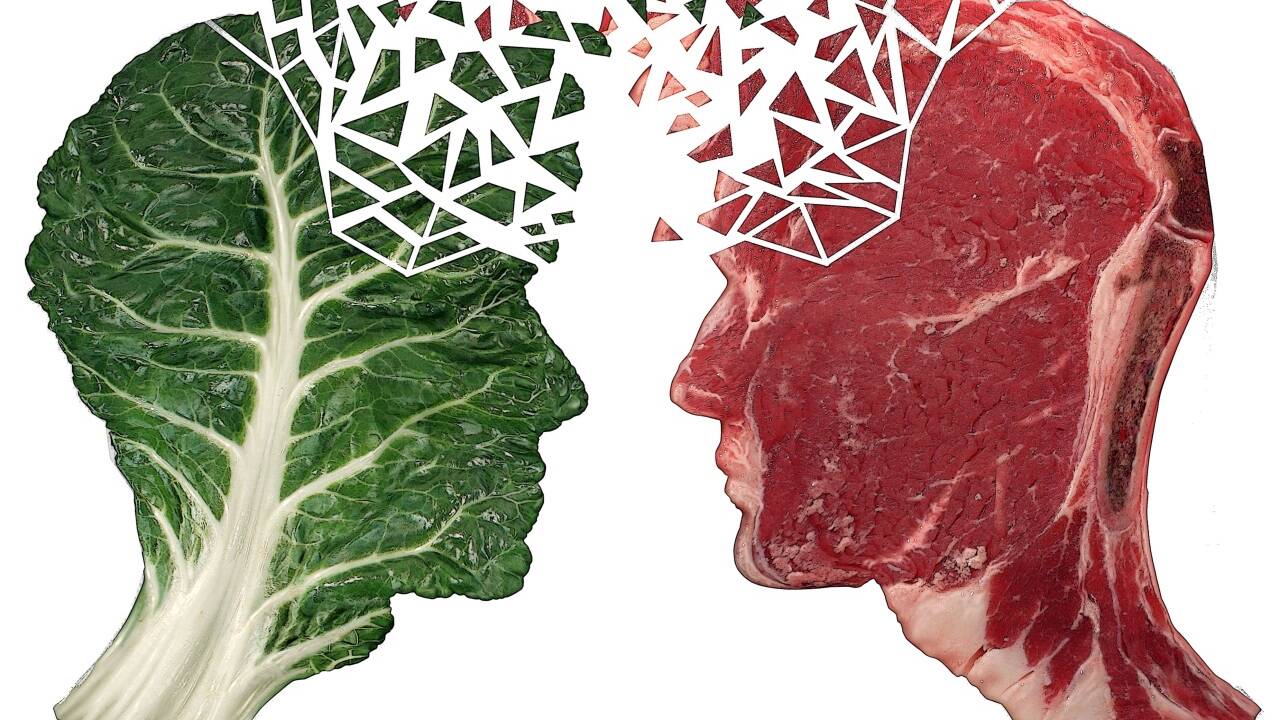Fleisch aus Massentierhaltung, wie es in Österreich massenhaft verzehrt wird, ist nicht gut - weder für die Umwelt noch für das Tier, und auch nicht für den Menschen. Das sagen mittlerweile nicht nur Veganer. Doch warum lehnen Veganer auch Biobauernhöfe - mit ihrem Tierbestand - ab?
Die vegane Lebensweise ist en vogue. Besonders unter den besser gebildeten Jungen, und besonders in Wien und den Landeshauptstädten, wo der nächste Bauer meist weit entfernt ist. Gleichzeitig tobt aber auch die Kontroverse um vegane Ernährung, sagen wir mal, recht heftig. Daher erscheinen nun Bücher wie jüngst "Vegan ist Unsinn", in dem Autor Niko Rittenau Argumente gegen den Veganismus zu entkräften versucht.
An solchen Vorurteilen gegen den Veganismus hat es keinen Mangel - etwa: Milchkonsum schadet den Tieren nicht, Veganismus ist unnatürlich, der Mensch ist Allesesser, vegane Ersatzprodukte sind pure Chemie, Veganismus fördert Essstörungen, Veganismus ist eine Religion - und last, but not least: echte Männer brauchen Fleisch!
Fleisch essen oder kein Fleisch essen - was ist böser?
Veganer hingegen bringen als Argument für die grün-bunte Ernährung oft vor, dass Nutztiere ja Getreide benötigen - und dass man mit diesem Getreide eine viel größere Menge Menschen satt machen könnte.
Die Ökotrophologin Ulrike Gonder behauptet hingegen, dass die Idee, mehr Getreide oder mehr Soja für eine wachsende Menschheit anzubauen, weder das Welthungerproblem löse noch die Umwelt schone. "Rinder, Ziegen und Schafe sind Weidetiere und standen nie in Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Jene Tiere essen das, was Menschen nicht nutzen können. Nämlich die Zellulose der Gräser, und wandeln sie in hochwertige Nahrung um", so Gonder.
Sie führt weitere Argumente gegen die vegane Ernährung an: Von fünf Milliarden Hektar urbarem Land weltweit seien 3,4 Milliarden Hektar Weideland. Also für Ackerbau ungeeignet. Wenn dieses Weideland in Ackerland umgewandelt würde, oder Wälder abgeholzt würden, um Äcker zu schaffen, sei die Folge oft Erosion, Versalzung, letztlich Verwüstung.
Renato Pichler, Präsident des schweizerischen Vegan-Verbands Swissveg, stört sich dagegen sehr an der Behauptung, dass über die Hälfte des urbaren Landes für den Ackerbau ungeeignet wären. "Diese Behauptung ist falsch. Nur weil heute sehr viel Land für Weideflächen genutzt wird, bedeutet dies nicht, dass dieses Land nicht für Ackerbau geeignet wäre."
Ein Großteil der heutigen Landflächen könnte auch für den Anbau von Essen genutzt werden, so Pichler. "Wenn auf einem Land keine Pflanzen wachsen, wächst auch kein Gras, und damit ist das Land als Weide nutzlos." Bei Böden, die sich angeblich nicht zu Ackerflächen eigneten, weil zum Beispiel ein zu trockenes Klima herrsche, fördere das Abweiden die Versteppung, hält Pichler dagegen. "Dadurch wird fruchtbares Land vernichtet", klagt Pichler. "Würde man diese kargen Flächen hingegen mit Obstbäumen aufforsten, hätte man innerhalb einiger Jahre ein viel besseres lokales Klima und könnte über Jahrzehnte ernten, statt nur wenige Jahre ein paar Ziegen weiden lassen, bis nichts mehr dort wächst.