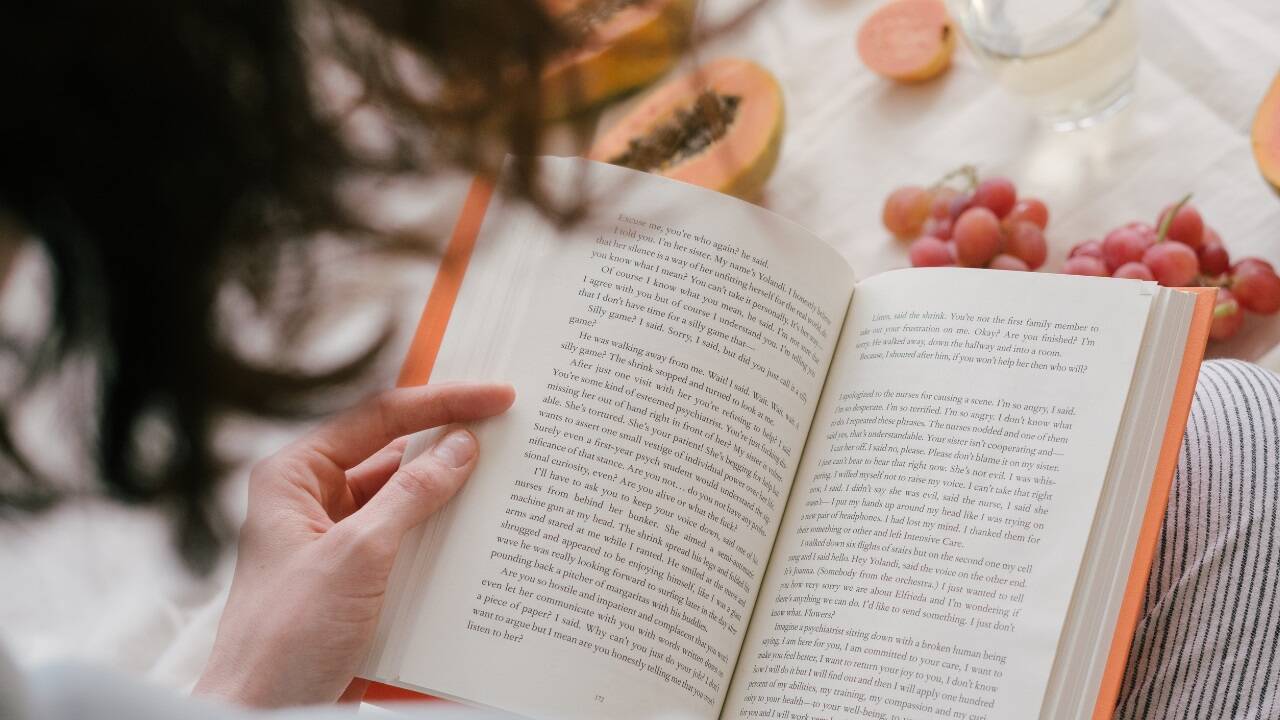Etwa 15 von 100 Erwachsenen können nicht richtig lesen. Die Hemmschwelle, sich Basiswissen im Erwachsenenalter anzueignen, ist groß. Welche Probleme im Bereich grundlegender Kenntnisse bringen Betroffene mit? Und: Welchen Stellenwert nimmt Basisbildung ein, wenn es um die gesellschaftliche Teilhabe geht?
Anna Stiftinger, Projektleitung "Fokus.Basisbildung" im Basisbildungszentrum abc-Salzburg, stellte sich den Fragen der SN.
Was genau versteht man unter dem Begriff "Basisbildung"? Anna Stiftinger: Basisbildung ist der Bereich der Erwachsenenbildung, in dem Menschen ab 16 Jahren nach absolvierter Schulpflicht Grundkenntnisse in den Bereichen Deutsch (Lesen, Schreiben, Sprechen) und Mathematik sowie im Umgang mit digitalen Medien aufbauen, auffrischen oder erweitern. Zusätzlich kann eine weitere Sprache, meistens Englisch, von Anfang an gelernt werden.
15 von 100 Erwachsenen können nicht richtig lesen - sollte dieses Problem nicht mit dem Pflichtschulabschluss verschwunden sein? Freilich sollten Kinder und Jugendliche nach Absolvierung der Pflichtschule ausreichende Kenntnisse in den Grundkompetenzen erlangt haben. Ergebnisse von Studien zeigen allerdings ein anderes Bild: Pirls (Progress in International Reading Literacy Study, Anm. der Red.) erhebt die Lesekenntnisse der Schülerinnen und Schüler in den vierten Klassen der Volksschule. Die Zahlen zeigen, dass jedes fünfte Kind in Österreich Probleme beim Lesen hat.
Die Ergebnisse der Pisa-Studie, hier werden Schülerinnen und Schüler gegen Ende der Pflichtschule getestet, machen deutlich, dass 24 Prozent der Jugendlichen Risikoschülerinnen und -schüler sind. Dies bedeutet, dass sie altersgemäße Texte nicht sinnerfassend lesen können. Wer am Ende der Pflichtschule nicht ausreichend sinnerfassend lesen kann, wird sich auch im Erwachsenenalter damit schwertun.
Wie kommt es dazu? Es sind immer vielfältige Gründe, die zusammenspielen, dass Personen das Pflichtschulsystem verlassen, ohne ausreichend lesen, schreiben oder rechnen zu können. Das können Schulwechsel, längere Krankheiten, schwierige Situationen in der Familie, aber auch in der Klasse sein. Manche berichten auch von mehreren Umzügen oder davon, dass Lesen und Schreiben in der Familie keinen besonderen Stellenwert hatten.
Von der Pirls-Studie wissen wir auch,
dass sich das Phänomen leider fortsetzt, wenn Eltern selbst nicht gut lesen und schreiben und damit ihre Kinder beim Erwerb dieser Kompetenzen auch nicht unterstützen können.
Welche Maßnahmen bräuchte es, um die Zahl derjenigen, die Lesen und Schreiben nicht ausreichend beherrschen, am effektivsten zu senken? Im Grunde müssten Lösungsvorschläge in zwei Richtungen gedacht werden: Erstens für Schülerinnen und Schüler, die jetzt und in der Zukunft ihre Schulpflicht absolvieren. Zweitens aber auch für all jene Betroffenen, die in den vergangenen Jahren das Schulsystem bereits verlassen haben und nun als Erwachsene vor täglichen Hürden stehen. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, an Kursen teilzunehmen.
Da wir als Erwachsenenbildnerinnen und -bildner nicht für die Primärbildung zuständig sind, sind wir auch nicht die Richtigen, Empfehlungen in diese Richtung abzugeben. Insgesamt sind wir aber der Meinung, dass sich Politik, Ämter und Behörden überlegen sollten, wie sie mit der zunehmenden Zahl an erwachsenen Betroffenen umgehen wollen. Über Kurse allein kann der Bedarf nicht abgedeckt werden. Es wird überall verstärkt Angebote geben müssen, bei denen Menschen Unterstützung finden. Beispielsweise in den Bewohnerservices, wenn es um das Ausfüllen von Formularen geht oder darum, wie Informationsschreiben viel niederschwelliger formuliert werden können.
Welchen Stellenwert nimmt Basisbildung ein, wenn es um die gesellschaftliche Teilhabe geht? Ausreichenden Basisbildungskenntnissen kommt ein hoher Stellenwert zu. Genügend Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen sowie ausreichendes Wissen im Umgang mit digitalen Geräten verbessern das Erwachsenenleben und erhöhen die Chancen, alltägliche Aufgaben selbstständig bewältigen zu können. Sprich: Formulare bei Ämtern und in Gemeinden auszufüllen, Infos aus Informationsblättern von Kindergarten und Schule oder aus Zeitungen zu entnehmen oder Sicherheitshinweise bei der Arbeit lesen und verstehen zu können. Wer beispielsweise keinen Wahlzettel lesen kann, wird wahrscheinlich auch nicht wählen gehen und damit - durchaus oft unfreiwillig - auf dieses wichtige demokratische Grundprinzip verzichten.
Lesen zu können und den Inhalt zu verstehen verschafft Menschen sehr viele Möglichkeiten. Immer mehr Dienstleistungen und Services, auch der öffentlichen Hand, sind mit digitalen Medien gekoppelt: Anträge und Ansuchen können oftmals nur mehr online eingereicht werden oder Fahrkarten nur am Automaten gekauft werden. Das heißt, Lesen, Schreiben und digitale sowie Medienkompetenz sind mittlerweile untrennbar miteinander verbunden.
Sie sind Projektleiterin des Bereichs "Fokus.Basisbildung" bei abc-Salzburg - was haben Sie sich in Ihrer Funktion zum Ziel gesetzt? Mit diesem Projekt möchten wir das Thema insgesamt in den Fokus rücken, damit über Basisbildungsbedarf viel mehr gesprochen wird. Wir wollen erreichen, dass die allgemeine Öffentlichkeit davon erfährt, dass es in ganz Österreich und besonders im Bundesland Salzburg kostenlose Kurse gibt. Eines unserer Ziele ist es, Basisbildung aus dem schambehafteten Eck herauszuholen - denn so viel ist sicher: Die Betroffenen sind nicht schuld daran, dass sie nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen gelernt haben.
Viele, die von "eine Million Betroffene in Österreich" hören, meinen zuerst, es würde sich ausschließlich um zugewanderte Menschen handeln. Das ist allerdings ein Trugschluss: Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen ist in Österreich geboren und hat das österreichische Pflichtschulsystem durchlaufen.
Aus Ihrem Erfahrungsschatz: Welche Probleme beziehungsweise Fragestellungen in Sachen grundlegende Kompetenzen sind am stärksten vertreten? Die Anliegen der Kursteilnehmenden sind breit gefächert: Im Bereich Schreiben geht es vom Ausfüllen von Formularen bis hin zum Verfassen von E-Mails, Briefen oder Berichten. Die einen wollen Schilder im öffentlichen Raum, die anderen berufliche Fachtexte lesen können. Rechnen betrifft das Ablesen von Uhrzeiten, Umrechnen von Maßeinheiten oder das Prozent- und Bruch-
rechnen. Kenntnisse im Bereich der digitalen Geräte sind gefragt, wenn es um das Bedienen von Geräten (dazu gehören auch Automaten und Smartboards), die Nutzung von Apps, Office-Programmen, Online-Services, aber auch die "digitale Selbstverteidigung" (wie etwa Copyright, Privatsphäre und sicheres Online-Shopping) geht.
In den Kursen mit dem Schwerpunkt Englisch sind grundlegende Kommunikationsthemen wie sich selbst vorstellen, Wege beschreiben, Gespräche führen, Beschilderungen oder Durchsagen verstehen gefragt. Immer wieder kommen auch Personen in die Kurse, die ohne Druck diese Grundlagen wieder auffrischen und mit größerer Sicherheit weiterführende Aus- und Fortbildungen besuchen wollen.
Wie groß ist die Hemmschwelle von Erwachsenen, sich in späteren Jahren noch Grundkenntnisse anzueignen? Derzeit ist die Hemmschwelle noch eine recht große. Wir arbeiten aber intensiv daran, dass dieses Thema enttabuisiert wird und aus der schambehafteten Ecke herauskommt. Unsere Vision ist, dass der Besuch eines Basisbildungskurses gleich wie jede andere Weiterbildung oder gar das Absolvieren der Matura im zweiten Bildungsweg gesehen wird. Dafür ist wichtig, dass über das Thema gesprochen wird - und zwar auf unaufgeregte Art und Weise.
In der Kommunikation ist uns wichtig, dass die Betroffenen erfahren, dass sie bei Weitem nicht die Einzigen sind, die sich in diesen Bereichen schwertun. Zudem ist zu sagen, dass die Kurse ganz anders ablaufen, als man es aus der Schule kennt. Das Lernen findet in kleinen Gruppen statt und es wird auf individuelle Bedürfnisse eingegangen. Eine Teilnehmerin hat es so formuliert: "Wenn ich gewusst hätte, dass Lernen so geht, wäre ich schon früher gekommen."
Welche Art von Kursen bietet abc-Salzburg konkret an? Das Basisbildungszentrum abc-Salzburg bietet Ganzjahreskurse an. Ein Mal in der Woche kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um in einer Kleingruppe mit bis zu sechs Personen zu lernen. Die Kurse haben unterschiedliche Schwerpunkte - sei es Lesen und Schreiben, Rechnen, digitale Kompetenz oder auch Englischgrundlagen.
Die Teilnehmenden entscheiden selbst, was sie lernen möchten, und die Trainerinnen und Trainer gestalten die Kurse auf Basis dieser Infos. Dabei kann es vorkommen, dass bei einem Kurstermin alle Teilnehmenden an unterschiedlichen Themen arbeiten. Insgesamt finden aktuell 17 Kurse in der Stadt Salzburg und 15 am Standort in Bischofshofen statt. Es gibt Vormittags-, Nachmittags- und Abendkurse.