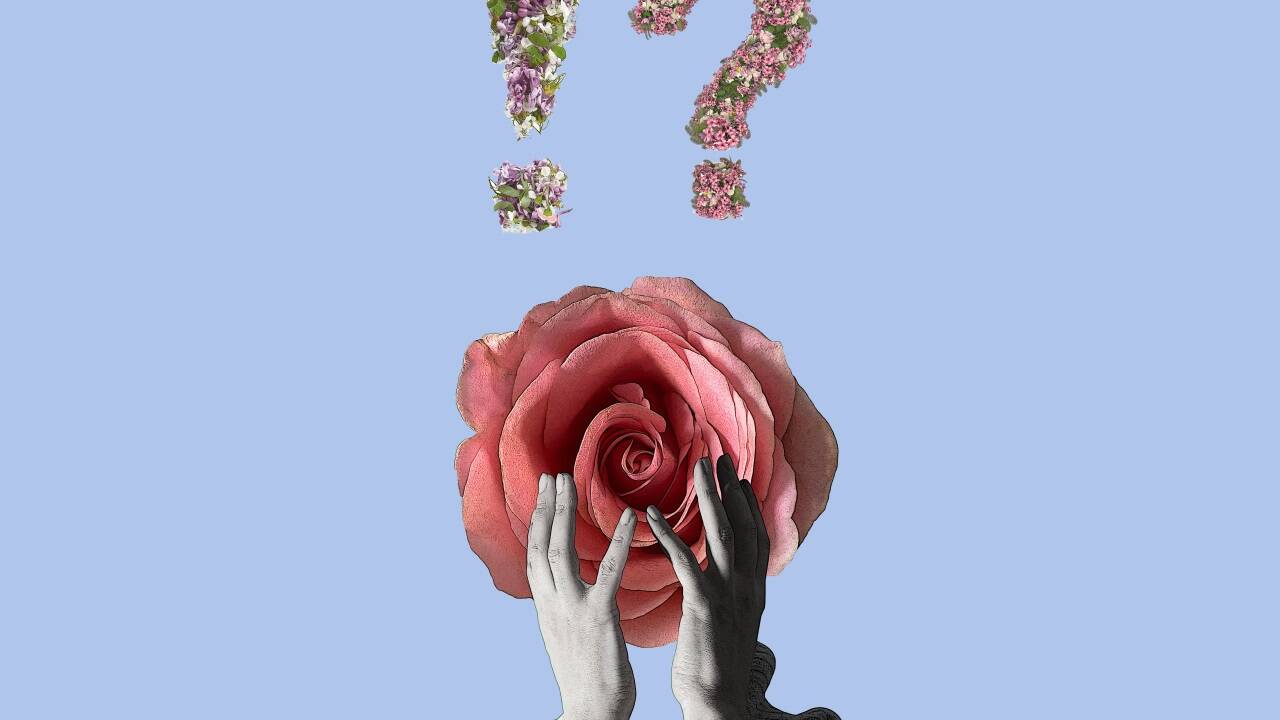So wirklich viel anfangen konnte Marco Schwaighofer mit der Leidenschaft seiner Mutter nicht. Sie hat vor 18 Jahren südlich von Graz landwirtschaftliche Fläche erworben, um Blumen anzubauen. Margrit de Colle ist Soziologin, war viele Jahre in der Entwicklungshilfe tätig und wurde 2008 zu Österreichs erster Bioblumenbäuerin. Sohn Marco stieß auf das Thema im Rahmen eines Praktikums in einem Labor, das Lebensmittel auf Pestizidrückstände testet, und forschte in der Universitätsbibliothek weiter. Was er fand, schockierte ihn: So wurde 1999 bei einer Untersuchung in Ligurien festgestellt, dass bei 60 Prozent der Menschen, die lange Zeit in der Blumenindustrie tätig waren, Krebs im Frühstadium diagnostiziert wurde. 2003 erschien eine Studie, wonach 71 Prozent der Blumenbauern und -gärtner Genschäden aufwiesen. 2017 wurden in Belgien Baumwollhandschuhe von Floristen untersucht und 111 Substanzen, hauptsächlich Insektizide und Fungizide, nachgewiesen.
80 bis 90 Prozent der in Österreich erhältlichen Blumen kommen aus dem Ausland, europäische Ware überwiegend aus Holland und Norditalien. Woher im Detail, ist nirgends vermerkt, es gibt keine Statistiken zum Blumenimportmarkt. Detail am Rande: Will man aus dem Urlaub eine exotische Pflanze mit nach Hause nehmen, benötigt man ein Pflanzengesundheitszeugnis. Dass Importblumen, insbesondere Rosen, mitunter stark pestizidverseucht sind, wird mittlerweile regelmäßig nachgewiesen. Zuletzt untersuchte Ökotest in Deutschland
21 Rosensträuße aus dem Einzelhandel. Mehr als drei Viertel wurden aufgrund der Pestizidbelastung mit mangelhaft oder ungenügend bewertet, darunter waren auch teure Sträuße von Blumenversendern.
Am besten schnitten die bei Aldi Süd erhältlichen Fairtrade-Rosen für 2,99 Euro ab. Über Holland kommen pro Tag neun Millionen Rosen in die EU. 77 Prozent stammen aus Kenia und Südamerika, dort ist für die Blumenzucht das Klima optimal, die Löhne sind gering und der Gifteinsatz ist ungeregelt. Fairtrade beispielsweise setzt sich in diesen Ländern unter anderem für faire Entlohnung und entsprechende Schutzkleidung ein, eigene Standards sorgen zudem für strenge Umweltkriterien und einen geregelten Pestizideinsatz. Jede dritte in Österreich verkaufte Rose kommt mittlerweile über Fairtrade.
Belastet sind aber nicht nur Schnittblumen, wie Untersuchungen von Global 2000 zeigten: Auch Zierpflanzen für Haus, Garten oder Balkon, die als bienenfreundlich ausgelobt werden, sind pestizidbelastet. Bei Lavendel, bekanntlich beliebt bei Bienen, würden immer wieder hohe Werte gefunden, sagt die Expertin für Pestizide und Chemikalien bei Global 2000, Waltraud Novak. Spitzenreiter im letzten Test waren Lichtnelken, auf denen 17 Giftstoffe nachgewiesen wurden, vier davon hochgefährlich für Bestäuber, zehn gesundheitlich problematisch bis krebserregend. Dass gerade auf sogenannten Bienenblühern Neonicotinoide gefunden werden, ein Gift, das Bienen schadet und in der EU mittlerweile verboten ist, erklärt Waltraud Novak so: Viele Anpflanzungen erfolgen in Nicht-EU-Ländern, und dort werden die Samen mit Neonicotinoiden gebeizt, um gegen Schädlinge resistent zu werden. "In den ausgewachsenen Pflanzen finden wir noch erstaunlich hohe Mengen", sagt Novak.