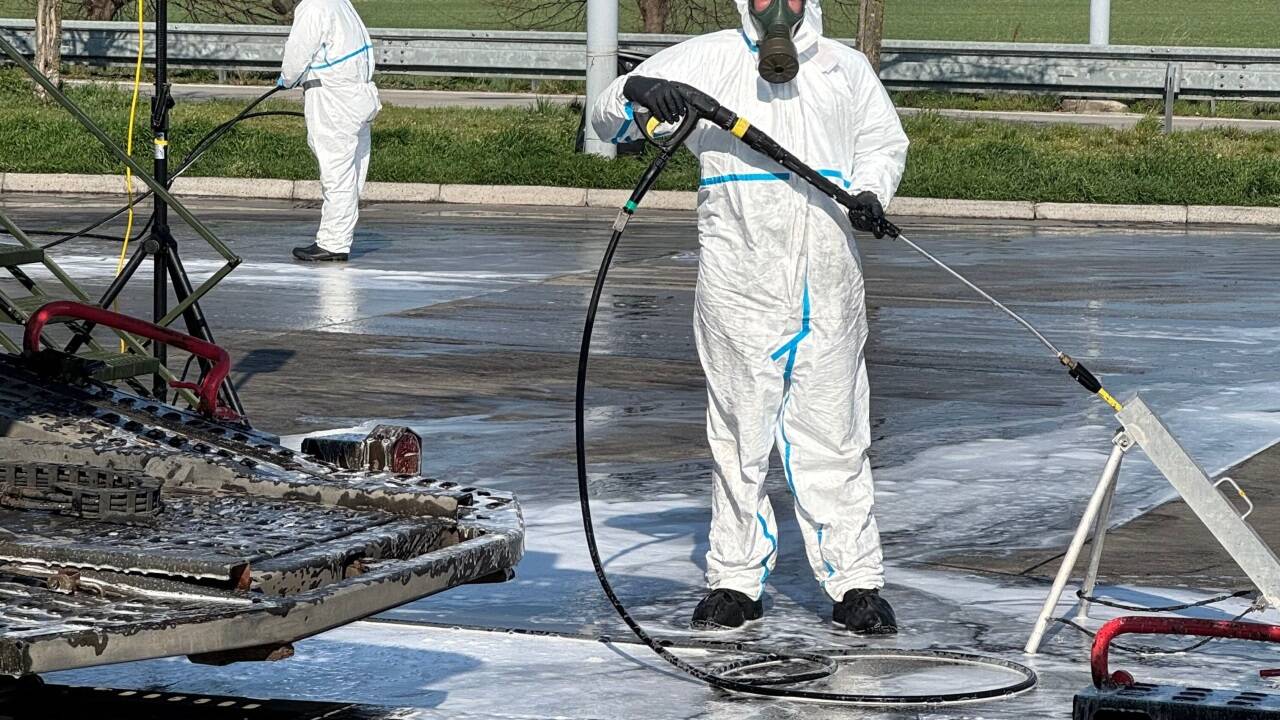Ungarn schließt einen biologischen Angriff als Ursache für den ersten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) im Land seit mehr als 50 Jahren nicht aus. Das erklärte Gergely Gulyás, Kanzleramtschef von Premierminister Viktor Orbán, der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Der Verdacht beruhe auf mündlichen Informationen eines ausländischen Labors, dessen Ergebnisse noch nicht vollständig belegt seien. Womöglich handle es sich um ein künstlich erzeugtes Virus.
Ist ein biologischer Angriff tatsächlich möglich? Claudia Schulz von der Abteilung Infektiologie und Virologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien verweist auf SN-Anfrage in diesem Zusammenhang auf einen MKS-Ausbruch im Jänner in Deutschland. Dort war eine Herde Wasserbüffel infiziert, weitere Fälle traten nicht auf. "Wir haben noch keine vollständigen Ergebnisse, wie die MKS-Viren eingetragen wurden. Aufgrund zweier kurz aufeinanderfolgender MKS-Ausbrüche in Europa, das als MKS-frei gilt, war die Überlegung, ob erst Deutschland bioterrorisiert wurde und jetzt Ungarn und so weiter. Es handelt sich aber um unterschiedliche Stämme, auch wenn es sich um denselben MKSV-Serotyp ,O' handelt. Wenn also jemand Europa wirklich gefährden wollte, würde er sich aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht so viel Mühe machen, unterschiedliche Stämme zu entnehmen und diese erst da und dann dort zu streuen."
In Deutschland hätten Untersuchungen gezeigt, dass die wahrscheinlichste Übertragungsquelle Reiserückkehrer gewesen seien, die spazieren waren und das Virus an der Schuhsohle oder Jacke mitgeschleppt hätten. Möglich sei auch, dass jemand Essensreste weggeworfen habe. Das Virus sei hochinfektiös, es reiche im Prinzip ein Partikel, um Tiere anzustecken. Auch seien Gebiete betroffen, in denen sich relativ wenige Tiere aufhielten. "Wenn jemand wirklich Bioterrorismus in Europa betreiben will, würde er zum Beispiel Westdeutschland nehmen. Da gibt es ganz viele Schweine und Rinder", sagt Schulz. Ausschließen könne man es aber ohne eindeutige Ergebnisse nicht.
Das Virus sei per se künstlich herstellbar, aber: "Das ist sehr aufwendig und das kann nicht jeder. Und wer würde das? Für mich ergibt das keinen Sinn." Ein künstliches Virus könne man an der Sequenz potenziell erkennen. Würde es sich um einen typischen Laborstamm handeln, könne man vermutlich Rückschlüsse ziehen, woher dieser komme. Zudem gebe es nur wenige Labors, die mit dem MKS-Virus arbeiteten.
Möglich sei hingegen dass das Virus versehentlich verschleppt wurde, da Sicherheitsstandards nicht eingehalten wurden. Als Beispiel nennt Schulz einen Ausbruch 2007 in Großbritannien. Dort kam es aufgrund undichter Leitungen in Labors zu Fällen von Maul- und Klauenseuche. Das habe man rasch in den Griff bekommen. "Diese Labors haben nicht umsonst so hohe Sicherheitsvorkehrungen; auch das Personal wird sicherheitsüberprüft."
Die Expertin verweist auch auf Parallelen zu Diskussionen um den immer noch nicht geklärten Ursprung des Coronavirus: "Hier hat man festgestellt, dass die Variante auch im Feld hätte entstehen können. Es wäre also nicht notwendig, es im Labor zu erzeugen."