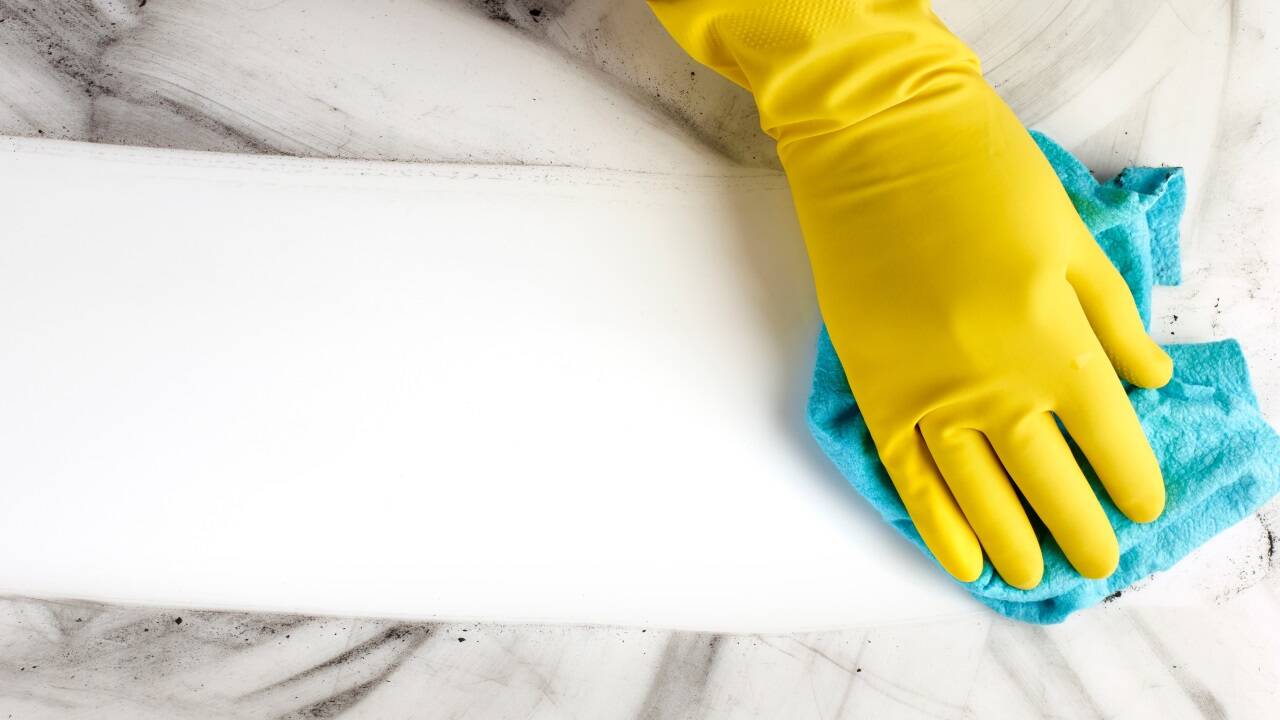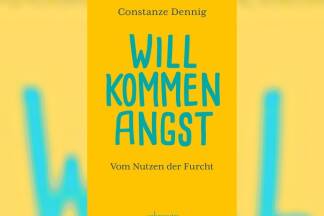Fachleuten zufolge zählen Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Österreich. Je nach Studie bzw. Schätzung sind 10 bis 16 Prozent betroffen; also 900.000 bis 1,44 Millionen Österreicher. Zudem leidet jede Vierte und jeder Vierter im Laufe des Lebens einmal an einer Angststörung. Diese alarmierenden Zahlen kennt auch die Psychiaterin, Neurologin und Psychotherapeutin Constanze Dennig - deren Sachbuch zum Thema Angst am Mittwoch erscheint.
Wann mann von einer Angststörung spricht
Wichtig sei, zunächst zu klären, ob die empfundene Angst ein normales Ausmaß habe oder bereits ins Pathologische gehe, sagt sie: "Angst wird dann krankheitswertig, wenn sie mich im Leben massiv beeinträchtigt und Entscheidungen, Arbeitsfähigkeit und soziale Kommunikation einschränkt." Solange man als Betroffener die Möglichkeit habe, sich von der Angst zu distanzieren weil man einen konkreten Grund bzw. Auslöser dahinter sehe, liege keine Krankheit vor. Ein Alarmsignal sei aber, dass viele Angsterkrankte Zwänge entwickeln würden, etwa einen Händewaschzwang, sagt Dennig. Zudem erkenne das Umfeld der betroffenen Person "häufig schneller als die Person selbst, dass hier ein Problem vorliegt." Weiteres Unterscheidungsmerkmal sei, ob es sich um eine diffuse, also eine nicht an reale Ursachen gekoppelte Angst, oder eine Angst mit klaren Auslösern dahinter handle, sagt sie.
Ursachen für die Zunahme an Angststörungen
Die Zunahme an Angststörungen führt Dennig auf die exorbitante Reizüberflutung durch unser von der Digitalisierung geprägtes Leben zurück: "Das Gehirn ist nicht auf diesen Zwang ausgerichtet, binnen Millisekunden entscheiden zu müssen ob ich etwa ein Mail lösche oder doch lese, weil es wichtig sein könnte." Denn das Gehirn funktioniere noch wie in der Steinzeit und könne daher nicht unterscheiden, ob der Angstreiz von Handy oder PC komme und daher nicht lebensbedrohlich sei - "oder doch vom Säbelzahntiger wie vor 20.000 Jahren."
Dennig (69) hat ihre Facharzt-Ausbildung am Neuromed Campus in Linz absolviert und später eine psychiatrische Praxis in Graz eröffnet. Aktuell ordiniert sie in Wien - und hat im Laufe der Jahre registriert, dass jüngere Menschen tendenziell mehr gefährdet seien, Angststörungen zu entwickeln - auch aufgrund von übermäßiger Computerspiel- und Social-Media-Nutzung: "Die 60-Plus-Generation kann da vielleicht besser mit Medien umgehen." Aus ihrer Erfahrung heraus seien zudem die vielen Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten der jungen Generation - etwa hunderte Studien- und Berufsmöglichkeiten nach der Matura zu haben - eine Überforderung: "Das erzeugt Stress, die richtige Entscheidung zu treffen. Und Stress und Überforderung machen auch Angst: Nämlich Angst vor dem Versagen und Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und sich Möglichkeiten zu verbauen." Zudem könne auch die allgemeine Weltlage - von Pandemie über Krieg bis Teuerung und Energieknappheit - Angst befördern, sagt sie.
Das passiert bei einer Angststörung im Körper
Was passiert bei Angst im Gehirn? Dennig erklärt, dass sie primär durch einen Sinnesreiz ausgelöst werde, der ein olfaktorischer, akustischer oder anderer Reiz sein könne, mit dem man schon einmal Angst verknüpft habe. Das perfide daran: "Dieser Reiz muss der betroffenen Person gar nicht unbedingt bewusst sein." Als Folge werden im Gehirn viele biochemische Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, ausgeschüttet, die eine Kaskade von Reaktionen in verschiedenen Hirnarealen, wie etwa dem Mandelkern (lat. Amygdala) auslösen: "Das führt zu einer Aktivierung des Körpers: Ich zittere und atme schneller, der Blutdruck steigt, der Herzschlag erhöht sich, manche beginnen zu schwitzen." Damit werde die Person extrem leistungsfähig, um wie in der Steinzeit vor einer Lebensgefahr fliehen zu können, sagt Dennig - was aber in der Moderne nicht mehr nötig sei. Das Problem: "Wenn der nun sehr hohe Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut nicht abgebaut wird, etwa durch körperliche Arbeit oder Sport, dann kann die Angst zum Dauerzustand werden," sagt die Expertin.
Medizinisch werden Angststörungen mit Psychopharmaka bekämpft, weil sie oft auch mit einer Depression gekoppelt sind. Parallel dazu ist auch eine Psychotherapie sinnvoll. Hier gehe es darum, sich mit der eigenen Angst zu konfrontieren, sagt Dennig: "So erlebe ich, dass ich mit der Angst fertig werden und sie überwinden kann."
Tipps, um Angststörungen selbst zu bekämpfen
Im Schlusskapitel des Buches gibt Dennig 16 konkrete Tipps, was man selber tun kann, um Angst zu bekämpfen: Denn Angst sei auch ein wichtiger Motor für Weiterentwicklung, Veränderung und Selbstakzeptanz, betont sie. Aber wie funktioniert das genau, Angst in positive Kraft umzuwandeln? Dennig: "Die Überwindung von Angst erzeugt Glück. Wenn ich beispielsweise trotz Prüfungsangst einen Test absolviere und nicht kneife, bin ich nachher glücklich."
Ihr erster Tipp lautet daher, sein Hirn einzuschalten und zu überprüfen, ob etwa die Angst , dass das eigene Kind am Schulweg von einem Auto überfahren wird, einen realen Hintergrund habe: "Da wird man schnell feststellen, dass dieses Risiko tatsächlich sehr gering ist." Ihr zweiter Tipp ist, genug Tageslicht zu konsumieren, um so den Serotoninspiegel nicht sinken zu lassen. Denn es sei kein Zufall, dass Ängste wie auch Depressionen vermehrt im Herbst und Winter auftreten. Ihre dritte Empfehlung lautet, bewusst auf körperliche Anstrengung und Sport zu setzen: "Nicht nur körperliche Arbeit, auch der anstrengende Wohnungsputz kann gegen drohende Angstzustände helfen", rät sie. Weitere Tipps lauten Ablenkung ("Unterbrechen Sie nächtliches Grübeln!"), gute Gespräche mit Freunden zu suchen, sowie, ein geordnetes, geregeltes Leben zu führen: "Denn jede Struktur gibt Halt und reduziert Stress - und ist gleichzeitig auch angstreduzierend."
C. Dennig: "Willkommen Angst. Vom Nutzen der Furcht." Ueberreuter; 160 Seiten.