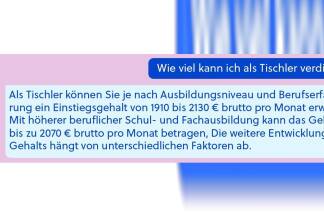PR-Vorwürfe stehen im Raum
Auch die Kosten von 300.000 Euro werden in der IT-Szene kritisiert. Der IT-Dienstleister Jobiqo, der auf Software für Jobplattformen spezialisiert ist, hat einen derartigen KI-Bot namens "Berufsberater Austria" mit ChatGPT in kurzer Zeit nachgebaut - für wenige Euro. Jobiqo-Geschäftsführer Martin Lenz findet es grundsätzlich gut, dass die öffentliche Verwaltung "mehr Mut zeigt und mit neuen Technologien experimentiert". Wenn aber mehr die PR im Vordergrund stehe, seien diese Lösungen sehr angreifbar, meint Lenz. AMS-Chef Kopf lässt den PR-Vorwurf nicht gelten. Der Berufsinfomat, der mit der Firma goodguys.ai und dem Bundesrechenzentrum umgesetzt wurde, wolle nicht nur auf ChatGPT-Wissen zurückgreifen, sondern werde mit den umfassenden AMS-Daten (Jobchancen, Gehälter, Skills etc.) gefüttert und laufend aktualisiert. So entstehe eine neue Wissenswelt, die mit fortlaufendem Betrieb auch die Antwortfehler, die ChatGPT erzeuge, bestmöglich unterbinden werde. "Naturgemäß" sei derartige Softwareentwicklung "teurer als Selbstgebautes", fügt Kopf hinzu.
Auch Kompetenz-Matching hatte für Kritik gesorgt
Schon im November hatte der AMS-Chef Kritik auf sich gezogen, als er das neue Kompetenz-Matching als "größte Innovation im AMS seit 25 Jahren" anpries. Statt (nur) auf Berufe abzuzielen, setzt die Arbeitsvermittlung in ihrem internen digitalen Suchsystem nun vor allem auf Kompetenzen. "Auch damit hat sich das AMS sehr weit hinausgelehnt", sagt Jobiqo-Geschäftsführer Lenz. Für das AMS sei das Kompetenz-Matching zwar ein Fortschritt, doch diese Technologie gebe es seit 20 Jahren, und der Markt habe zwischenzeitlich drei weitere Technologiesprünge erlebt. AMS-Chef Kopf räumt ein, dass die Technologie "nichts sensationell Neues" sei.
Durch das Abgleichen "zahlloser Kriterien" schaffe sie aber wesentlich bessere Suchergebnisse. IT-Mann Lenz bezweifelt, dass die enorme Dynamik des Arbeitsmarkts damit abzubilden sei. Bei den jüngsten Technologieschüben in der Branche habe sich etwa gezeigt, dass die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer ein Schlüsselfaktor für (noch) bessere Treffer sind. Welche Jobanzeigen hat sich ein Suchender früher angeschaut oder gemerkt, was interessiert ihn? Zehn Millionen Bewerbungen liefen jährlich über die Plattformen, die Jobiqo betreut. "Je mehr wir dabei auf Interessen abstellen, desto höher und besser ist die Trefferzahl." Und nun kämen Modelle generativer künstlicher Intelligenz hinzu, die diesen Plattformen völlig neue Möglichkeiten eröffneten. Sofern man es klug und nachhaltig anwende, fügt er hinzu.
AMS-Chef Kopf: "Da ist ein Riesending dahinter"
Den Vorwurf, "ein eher starres System" zu nutzen, lässt AMS-Chef Kopf nicht gelten. "Da ist ein Riesending dahinter", das mit viel Forschungsarbeit nun "State of the Art" sei. Er erinnert an die 25.000 beruflichen Kompetenzen, die nun im System hinterlegt seien und die 17.500 Berufsbezeichnungen ergänzten. Quasi in Echtzeit reihe das System dann die am besten qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber für eine Stelle in Prozentsätzen. Auch KI komme zum Einsatz, indem die Maschine Stellenangebote wie auch Lebensläufe auslese und automatisiert Vorschläge für ableitbare Kompetenzen von Suchenden sowie Anforderungen der Betriebe mache. Die würden aktuell von AMS-Beschäftigten bewertet, um die KI besser zu machen.
System soll kontinuierlich weiterentwickelt werden
Das vollwertige AMS-System steht aktuell ausnahmslos den Beschäftigten im AMS zur Verfügung. Warum öffne man es nicht für Unternehmen wie Suchende, fragt Martin Lenz von Jobiqo. So könnte man die Nutzererfahrung samt deren Interessen mitberücksichtigen. AMS-Chef Kopf betont, dass das System dazu bereits in der Lage wäre, entgegnet aber: "Man darf die Komplexität nicht unterschätzen." Da gebe es zahlreiche rechtliche und organisatorische Punkte zu klären. Deshalb setze man jetzt "auf bewältigbare Schritte", entwickle das System kontinuierlich weiter und wolle es später "auch für unsere Kundschaft öffnen". Nach den ersten Erfahrungen mit dem KI-Berufsinfomat wird diese Vorsicht wohl noch größer geworden sein.
Ihm gehe es nicht darum, die AMS-Aktivitäten schlechtzumachen, betont Jobiqo-Chef Lenz. Ihn stört, dass es so gut wie keinen öffentlichen Diskurs gebe, wie das AMS mit der Digitalisierung seine Jobvermittlung besser und effizienter machen kann. "Und da gibt es deutlich mehr und Besseres als das, was derzeit angepriesen wird."