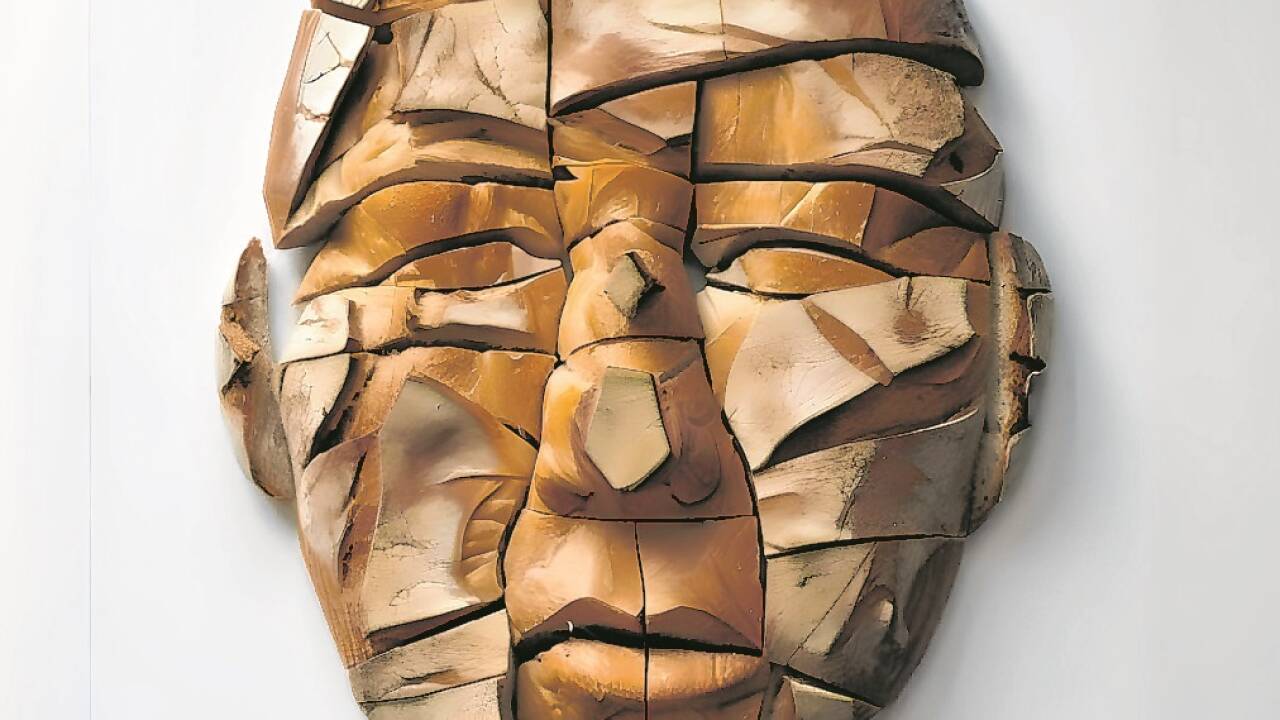Sauerkraut. Most. Essig. Kann nicht sein. Noch einmal. Und wieder: Sauerkraut. Most. Essig. Vielleicht Essig vor Most. Aber Sauerkraut bleibt auf Platz eins. Einfach deshalb, weil es einem als Erstes einfällt, wenn man die Nase in die Schüssel hält, in der sich zuvor lediglich vier unterschiedliche Mehle befanden. Von ganz weiß bis ziemlich graubraun. Jetzt liegt obendrauf diese blubberige Masse, dieses schimmernde Lebewesen mit all seinen Bläschen. Das Gehirn sagt: Ja klar, es kann sich nicht bewegen. Zumindest tut es das derart langsam, dass es das Auge nicht zu erkennen vermag. Doch ebendieses Auge fühlt sich jetzt getäuscht und meldet: Schau, da tut sich etwas, eindeutig.
Was bedeutet die Zahl hinter dem Mehlbezeichnung?
Der Chef heißt Paul und ist begeistert. Denn das, was sich da in der Schüssel befindet, ist sein Ein und Alles. Moment, nicht ganz, natürlich. Die Leni, die weiter drüben im Geschäft steht, ist sein Ein und Alles. Aber sie muss sich die Position teilen. Denn der Paul ist Bäcker. Und was für einer. Einer mit Haut und Haaren. Einer, der Mehl statt Blut in den Adern hat. Okay, das klingt jetzt blöd. Nur, wie beschreibt man einen Mann, der so brennt für sein Handwerk? Am besten, wenn man in diese Schüssel blickt. In die hat der Paul 120 Gramm Roggenmehl 2500, 150 Gramm Roggenmehl 960, 100 Gramm Weizenmehl 700 und 50 Gramm Weizenmehl 1600 gegeben. Nein, die Zahlen hinter den Mehlen sind keine Kubikzentimeter. Sie zeigen an, wie viel Mineralstoffe in der Masse sind. 960 heißt: 960 Milligramm Mineralstoffe auf 100 Gramm Mehl. Simpel zusammengefasst: Je höher die Zahl, desto gesünder der Grundstoff. Dieses Roggenmehl 2500 ist somit saugesund. Wenn man das so sagen darf.
Der Vorteig muss ruhen
Nun, das alles mag ja schön und gut sein. Aber so richtig spannend ist diese Blubbermasse obendrauf. Experten sagen dazu auch gerne: Vorteig. Oder Sauerteig. Für den sollte man sich unbedingt Zeit nehmen. Umgerechnet: Bäcker, die es eilig haben, können niemals gute Bäcker sein. Eselsbrücke: Der Vorteig ist vom Vortag. Mindestens. Denn die 100 Gramm Mehl, vermischt mit 100 Gramm badewannenwarmem Wasser sollten 16 bis 18 Stunden ruhen. Der Paul sagt dazu gern: Länger ist immer besser. Also dürfen es auch 24 Stunden sein.
Germ ist beim Brot machen eigentlich nicht nötig
Ach ja, Folgendes: Bei Wasser darf man ruhig Gramm sagen. Denn Gramm und Milliliter sind vom Gewicht her dasselbe. Sonst sollte man das nicht tun. Denn hundert Milliliter flüssiges Blei sind sicher nicht 100 Gramm. Dieser Vorteig/Sauerteig hält bis zu einen Monat im Kühlschrank. Er ist quasi das Triebmittel. Und riecht nach Sauerkraut, Essig und ein bisserl nach Most. Ohne ihn: kein Brot. Germ, also Hilfstriebmittel, braucht der Paul nicht. Er sagt, man könne schon ein paar Gramm verwenden. Damit man auf der sicheren Seite ist. Aber nötig sei das nicht. Nur Mehl und Wasser. Ist doch ein Traum, oder? So, sachlich bleiben: Salz, Brotgewürz und 300 Gramm kaltes Wasser in die Schüssel. Ja, kaltes. Denn durch das Kneten erhöht sich die Temperatur im Teig ganz von selbst auf 26 bis 30 Grad. Mehr wäre nicht so gut. Weil man dann glaubt, der Teig sei zu flüssig und Mehl nachkippt. Jetzt: Kneten. Kneten. Kneten. Am besten so lange, bis die Masse nicht mehr ganz so pickt. Und sie pickt anfangs ganz unglaublich. Vor allem an den Fingern. Teig zurückklappen, mit dem Handballen nach vorne drücken und im 90-Grad-Winkel drehen. Schafft man diese Bewegung ein bis zwei Mal in der Sekunde und ohne hinzuschauen, ist man Paul. Also Profi. Es mag jetzt eigenartig klingen, aber das war's im Prinzip.
Nach Belieben formen, ab damit ins Simperl, den Gärkorb, und wieder ruhen lassen. Eine Stunde wäre optimal. Danach 40 Minuten bei 230 Grad im Backofen oder -rohr. Dann ist das Maria-Theresien-Brot fertig, ein sehr traditionelles Backwerk. Und eines von 3000 Arten von Brot im deutschsprachigen Raum. Viel Spaß bei der Auswahl!
Ein herzliches Dankeschön an https://www.paulsbrotmacherei.at