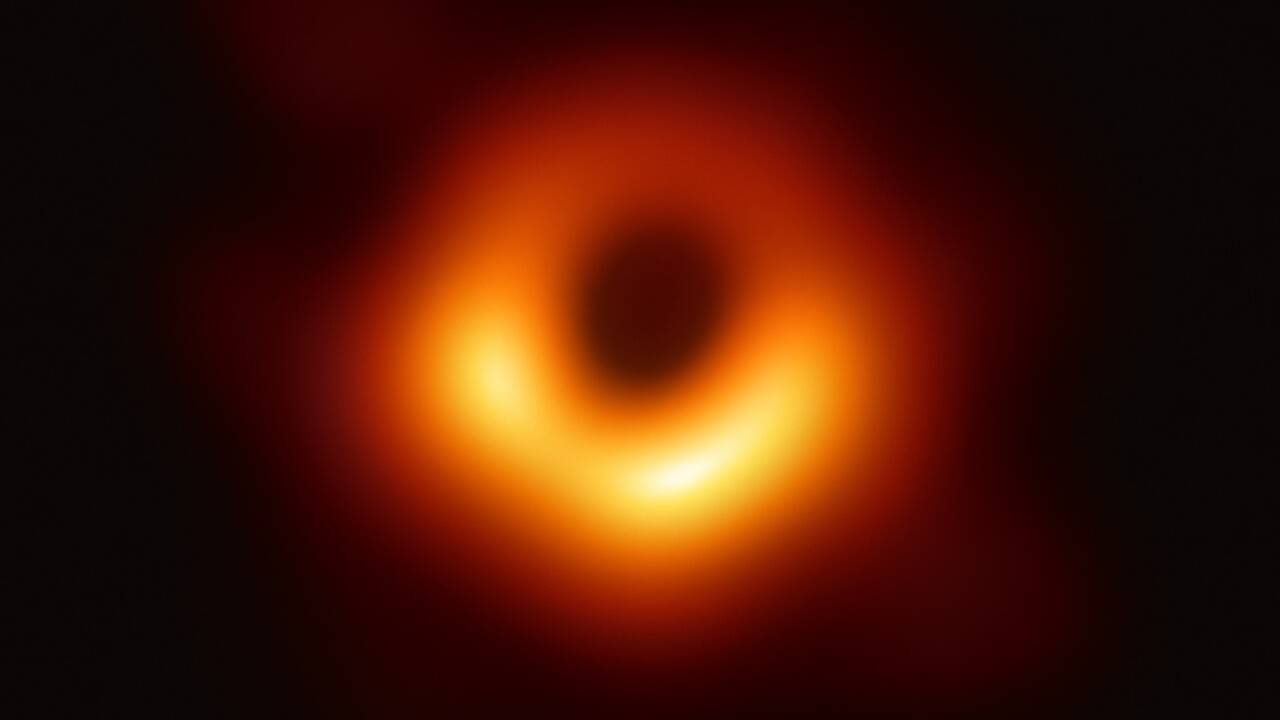Die Theorie, dass es im All ein dunkles Objekt gibt, dessen Gravitation sogar Licht gefangen halten kann, gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Der Beleg, dass schwarze Löcher tatsächlich existieren, konnte aber erst rund 240 Jahre später geliefert werden. Und zwar von einem Astrophysiker, der in der Nähe von München forscht: Der gebürtige Hesse Reinhard Genzel entdeckte - beinahe zeitgleich mit der US-Astronomin Andrea Ghez - Sagittarius A*, ein schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße. Für seine Forschung wurde der Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching 2020 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Im SN-Interview spricht der 69-Jährige über seine Entdeckung - und über so manch anderes stellares Rätsel.

Herr Genzel, Sie sagen, Sie seien ein Anfänger, was schwarze Löcher anbelangt. Wie kann es sein, dass der dafür prämierte Nobelpreisträger ein Anfänger ist? Reinhard Genzel:(lacht) Man hat immer nur einen bescheidenen Überblick über ein Forschungsfeld. Und es gibt natürlich immer wieder neue Entwicklungen. Die allgemeine Relativitätstheorie, die das Ganze unterfüttert, ist eine sehr komplexe mathematische Theorie, die ich in groben Umrissen verstehe - aber ich bin bestimmt kein Experte.
Was ist so komplex? Was macht schwarze Löcher aus? Schwarze Löcher haben zwei zentrale Eigenschaften. Zum einen soll das Wort "schwarz" ausdrücken, dass diese Objekte eine Schwerkraft haben, die so groß ist, dass selbst das schnellste, das wir zur Verfügung haben - das Licht -, nicht mehr herauskommt. Um es zu verdeutlichen: Stellen Sie sich eine Rakete vor, die von der Erde ins All fliegen will. Diese braucht dafür eine gewisse Mindestgeschwindigkeit. Wenn Sie nun die Erde kleiner machen, wird die Schwerkraft auf der Oberfläche größer, die Rakete braucht also eine höhere Geschwindigkeit, um abheben zu können. Wenn Sie den Gedanken immer weitertreiben, landen Sie irgendwann bei einer Mini-Erde, bei der selbst Lichtgeschwindigkeit nicht mehr reicht, damit die Rakete wegkommt. Wenn Sie sich dieses Prinzip vergegenwärtigen, haben Sie einen Aspekt eines schwarzen Lochs voll verstanden.
Und der zweite Aspekt? Wenn Sie die Rakete umdrehen und nach innen fliegen, sagt die Theorie, dass Sie die Rakete nicht mehr anhalten können. Sie können nur noch in endlicher Zeit im Zentrum ankommen. Und dort ist die Energie, die Masse des schwarzen Lochs, auf einen Punkt vereinigt. Sie haben also eine Singularität - eine unendlich hohe Dichte. Eben das können wir aber anhand der Relativitätstheorie weder belegen noch widerlegen. Auch nicht durch Experimente. Denn wir können, in der Theorie, zwar reinfliegen, aber wir können nicht mehr erzählen, was wir dort gemessen haben - da wir nach außen nicht mehr kommunizieren können.
Wenn noch nicht mal die Eigenschaften von schwarzen Löchern vollends geklärt sind, wie konnten Sie ein solches experimentell belegen? Wir haben die Vermutung aufgestellt, dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein schwarzes Loch befindet. Im nächsten Schritt guckten wir, ob sich dort Testteilchen - Gaswolken und Sterne - besonders schnell bewegen. Denn das wäre ein Anzeichen, dass sich irgendwo eine große Masse befindet. Und in der Tat: Das haben wir festgestellt. Nach fünf bis zehn Jahren Forschung wussten wir schließlich, dass es sich um eine Masse von vier Millionen Sonnenmassen handelt.
Aber woher wussten Sie, dass diese Masse wirklich ein schwarzes Loch ist? Wir mussten immer genauer, immer schärfer messen. Irgendwann war es so, dass man alles andere ausschließen konnte - aber nur, wenn die allgemeine Relativitätstheorie richtig ist. Also mussten wir noch belegen, dass selbst auf diesen Skalen die Relativitätstheorie erfüllt ist. Und auch das haben wir gemacht. Sodass jetzt die meisten Physiker überzeugt sind, dass es sich um ein solches Objekt handelt.
Die meisten? Könnte Ihre Entdeckung widerlegt werden? Auch das Nobelkomitee lässt - mit gutem Grund - in seiner Begründung zum Nobelpreis die These zu, dass wir vielleicht doch erkennen, dass hier die allgemeine Relativitätstheorie nicht richtig ist. Das ist zwar beliebig unwahrscheinlich, würden die meisten Physiker sagen. Aber man muss sich das als Forscher offenhalten. Es ist unsere Pflicht, nicht mehr zu sagen, als wir beweisen können.
Wie weit entfernt ist das von Ihnen entdeckte schwarze Loch überhaupt? Es ist 27.000 Lichtjahre entfernt. Was wir dort sehen, ist also die Vergangenheit: Wir sehen das Licht, das vor 27.000 Jahren dort vom galaktischen Zentrum weggeflogen ist. Für unsere Skalen ist das aber quasi vor der Haustür. Wir vermuten mittlerweile ja, dass jede Milchstraße im Universum ein schwarzes Loch hat. Die meisten von ihnen sind aber viel zu weit entfernt, um derart präzise Tests zu machen.
Das heißt, schwarze Löcher in irgendeiner Form nutzen zu können ist unwahrscheinlich? Darüber wird ja gerne spekuliert. Ja, das ist echt unwahrscheinlich. Rechnen Sie sich aus, wie lange Sie brauchen würden, um dort anzukommen. Da kommen Sie auf Millionen von Jahren. Urlaubsausflüge zu schwarzen Löchern müssen wir uns also abschminken. Ebenso wie irgendeinen praktischen Nutzen.

Kommen wir zum Nobelpreis: Ist eine solche Auszeichnung tatsächlich eine Zäsur im Leben eines Wissenschafters? Ja, es ist schon eine Zäsur. Aber es hängt auch stark davon ab, wann man sie kriegt. Ich bin 69 Jahre alt, insoweit bin ich am Ende meiner Karriere. Ich hatte auch Glück - wenn man das Glück nennen darf: Kollegen haben mich gewarnt, dass jetzt die härteste Zeit meines Lebens kommt, da einen jeder für einen Vortrag einladen will. Das war aber aufgrund der Pandemie nicht möglich. Ich konnte stattdessen alles von hier aus machen. Parallel bin ich noch stärker zu einem Botschafter der Forschung geworden. Das ist spannend, aber nicht immer einfach. Manchmal macht man etwa Fehler, weil man über das, was man sagen sollte, hinausgeht.
Inwiefern? Ich sage ja, ich weiß wenig über mein eigenes Forschungsgebiet. Noch weniger weiß ich über Covid-19. Dennoch fragen mich die Leute danach. Da muss man aufpassen, dass man nicht fehlgeht. Jedenfalls ist es wichtig zu zeigen, wie elementar Grundlagenforschung ist. Und wir müssen der Bevölkerung klarmachen, was wir mit ihren Geldern tun. Ich hoffe, dass ich da was zurückgeben kann. Etwa auch der österreichischen Bevölkerung. Denn wir arbeiten ja mit der Europäischen Südsternwarte (ESO) zusammen - und da ist ebenso Österreich per Förderung beteiligt.
Stichwort Covid-19: Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf Ihren Forschungsbereich? Die für uns wichtigsten Teleskope stehen in der Atacama-Wüste in Chile auf einem 2600 Meter hohen Berg. Nachdem die Pandemie in Chile zugeschlagen hatte, musste das Observatorium geschlossen werden. Es gab so fast ein Jahr lang keine Beobachtung. Jetzt sind wir in einer Phase, in der im limitierten Betrieb weitergearbeitet wird. Vieles muss etwa von der ESO elektronisch gemacht werden: Steht eine Reparatur an, sitzt bei der ESO ein Ingenieur und weist in Chile einen anderen Ingenieur per Zoom-Call an. Aber immerhin haben wir in diesem Jahr Daten bekommen. Andere Teleskope sind noch komplett zu. Das hat im Wissenschaftsbetrieb erheblichen Einfluss.
Noch eine Frage, mit der Sie sicher gerechnet haben: Werden wir irgendwann außerirdisches Leben entdecken? Die Forschung erfragt gerade, ob es auf Exoplaneten Leben gibt - übrigens auch mit einem Gerät, das wir gebaut haben. Mit diesem kann man die chemische Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten analysieren. Vielleicht wird es mal so weit kommen, dass man sagt, die Chemie eines Exoplaneten kann nur so sein, wie sie ist, wenn es dort eine Form von Leben gibt.
Sie glauben, dass wir außerirdisches Leben entdecken? Oh ja. Dass wir mit denen telefonieren können, wird aber schwierig. Schauen wir uns nur mal die Erde an: Das erste Leben gab es vor rund 1,8 Milliarden Jahren, die ersten Fische hatten wir vor grob 600 Millionen Jahren und der Mensch kam vor fünf Millionen. Das sind immense Zeitspannen. Dass wir die richtige auf einem anderen Planeten treffen, ist nicht einfach. Dazu kommt: Wenn irgendwo auf einem Exoplaneten ein Neandertaler rumhüpft, wird er wohl nicht die Technologie haben, um mit uns zu reden (lacht). Aber, machen wir eine Wette?
Ja, gerne. Ich glaube, in 30 oder 40 Jahren werden wir Evidenz haben, dass es auf dem einen oder anderen Exoplaneten eine Chemie gibt, die dafür spricht, dass sie nur durch aktives Leben möglich ist.
Was hält der Astrophysiker eigentlich vom Weltraumtourismus à la Bezos? Würde ich völlig offen darüber sprechen, würde ich sehr böse Worte finden ... Die wollen ja nicht nur da oben rumfliegen und Hurra schreien. Die wollen beliebig viele Kleinsatelliten installieren, damit Social Media noch mehr befeuert werden kann (gemeint sind Internetsatelliten wie jene von Elon Musk bzw. Starlink, Anm.). Werden die Pläne umgesetzt, würde das bedeuten, dass wir in 20, 30 Jahren keine bodengebundene optische Astronomie mehr machen können. Denn dann werden so viele Satelliten rumfliegen, dass der Nachthimmel hell wird. Warum muss das denn sein?
Zum Abschluss: Ihr Vater war selbst Wissenschafter, gar ein Pionier der Infrarotphysik. Kann man das Interesse an der Wissenschaft vererben? Ich wollte zuerst Archäologe werden. Das fand mein Vater in Ordnung. Irgendwann habe ich mich in Richtung Physik und Chemie bewegt. Und da war er dann besonders begeistert. Er hat mir etwa Dinge beigebracht, die ich in der Schule nicht gelernt habe. Dazu kommt: Er war auch Direktor an einem Max-Planck-Institut. Er hat mir also die Max-Planck-Gesellschaft ans Herz gelegt. Und das ist wohl mit ein Grund, warum ich hier bin - und nicht etwa in Berkeley, wo ich zwischendurch gearbeitet habe. Insofern ja: Das Interesse an der Wissenschaft ist bis zu einem gewissen Grad vererbbar. Und das ist auch wichtig: Wir müssen die Jugend von der Forschung begeistern. Nur so kommen wir als Menschheit weiter.