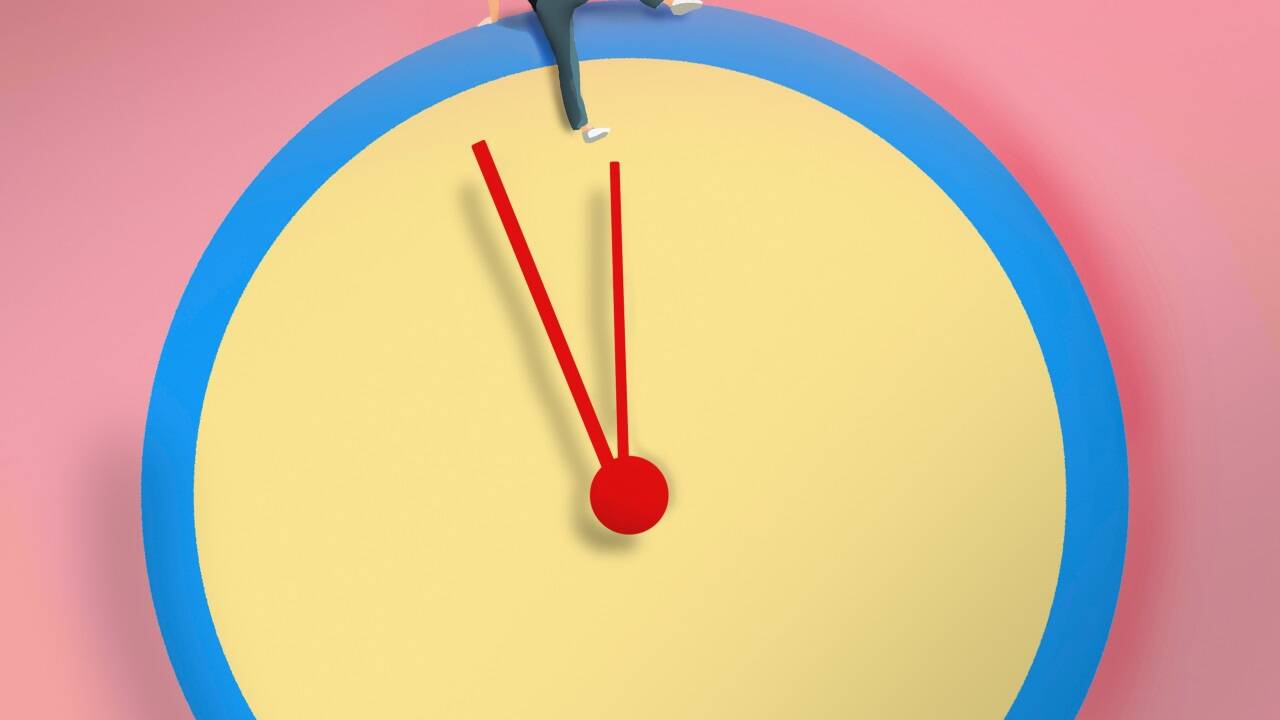Der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist enorm. Kindern wird bereits früh beigebracht, Erfolge zu liefern. Auch später gilt oft: Wer viel leistet, ist erfolgreich. Das klingt verlockend nach Freiheit, hat jedoch Tücken. Der ständig erzeugte Stress lässt uns an die Grenzen des Machbaren gehen. Doch was passiert eigentlich, wenn wir Stress ausgesetzt sind?
Veronika Engert ist Psychologin am Universitätsklinikum Jena und am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und beschäftigt sich seit geraumer Zeit damit, was im Körper passiert, sobald es stressig wird. "Die Stressreaktion teilt sich hauptsächlich in zwei Komponenten", sagt sie. Einerseits sorgt das sogenannte sympathische Nervensystem für die Freisetzung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin. Andererseits mobilisiert die sogenannte HPA-Achse langfristige Energien und schüttet ein weiteres Stresshormon aus: Cortisol.
Herausforderungen früher und heute
Die Stressreaktion des Körpers sei eine Art Notfallprotokoll aus der Steinzeit, sagt Engert: Binnen Sekunden wird der Körper mit Energie geflutet, damit wir eine potenziell lebensbedrohliche Situation meistern können. Unsere Sinne werden schärfer, unsere Muskeln stärker durchblutet und alle verfügbare Energie wird mobilisiert. "Wir brauchen diese Reaktion, um in stressigen Situationen adäquat reagieren zu können", sagt die Expertin. In der Steinzeit war das etwa der Angriff eines Bären: "Da mussten wir schnell handeln."
Heute sind die Herausforderungen andere. "Das Problem liegt nicht in der Stressreaktion selbst, sondern darin, was uns stresst", gibt Engert zu bedenken. Vor allem seien das psychosoziale Stressoren wie soziale Vergleiche, Druck, Hektik, Lärm oder Multitasking. "Es sind keine lebensbedrohlichen Situationen wie der Angriff eines Bären, aber unser Körper reagiert darauf in gleicher Weise."
Der Unterschied zu früher ist auch: Bei vielen Menschen tritt kaum mehr Erholung ein, da sie so häufig gestresst sind. Zahlreiche Umfragen belegen, dass das Stressempfinden der Menschen zugenommen hat. "Das hat sich auch durch Corona weiter verschärft", sagt Engert. Auch das bloße Gefühl, gestresst zu sein, ohne eine echte Gefahr als Ursache gehe mit derselben Reaktion des Körpers einher - also mit der Aktivierung der beiden Achsen im Körper.
Langfristige Effekte von Stress
Stresshormone wie Cortisol können positive Effekte haben, wenn der Körper schnell reagieren muss. Langfristig wirken sie sich negativ auf unsere Gefäße und unser Herz aus. Typische stressassoziierte Erkrankungen sind etwa Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, aber auch Unfruchtbarkeit. Dazu kommt: "Langfristig kann die vermehrte Freisetzung der Stresshormone dazu führen, dass unser Immunsystem unterdrückt wird", sagt Psychologin Engert.
Das bewies vor Kurzem auch eine Studie der Universität von Südkalifornien. Forschende wissen zwar schon länger, dass vor allem psychischer Stress Einfluss auf unsere Abwehrkräfte haben kann. In der Untersuchung wurden nun die dahinterliegenden Mechanismen dargelegt. Demzufolge beeinflusst Stress die Neuronen im Zwischenhirn, die wiederum die weißen Blutkörperchen stimulieren und im Körper verschieben können. Diese eigentlich für die Immunabwehr notwendigen Zellen sind somit nicht mehr ausreichend in der Lage, die Abwehr von Viren zu gewährleisten. Vor allem sozialer Stress, Mobbing und Depressionen führen der Studie zufolge zu einem schneller alternden Immunsystem.
Stress kann ansteckend sein
Generell geht es aber nicht nur um den Stress, den man am eigenen Leib erfährt. "Es reicht sogar, wenn man den Stress der anderen miterlebt", sagt die Psychologin. Das sei quasi ansteckend und könne möglicherweise negative Auswirkungen auf die eigene Gesundheit haben. Das Team um Engert ließ dafür Menschen im Labor anderen gestressten Leuten zuschauen. Es zeigte sich: Je näher sie der gestressten Person waren, desto stärker reagierten sie auch selbst. Die Reaktion war zudem stärker, je empathischer eine Person ist.