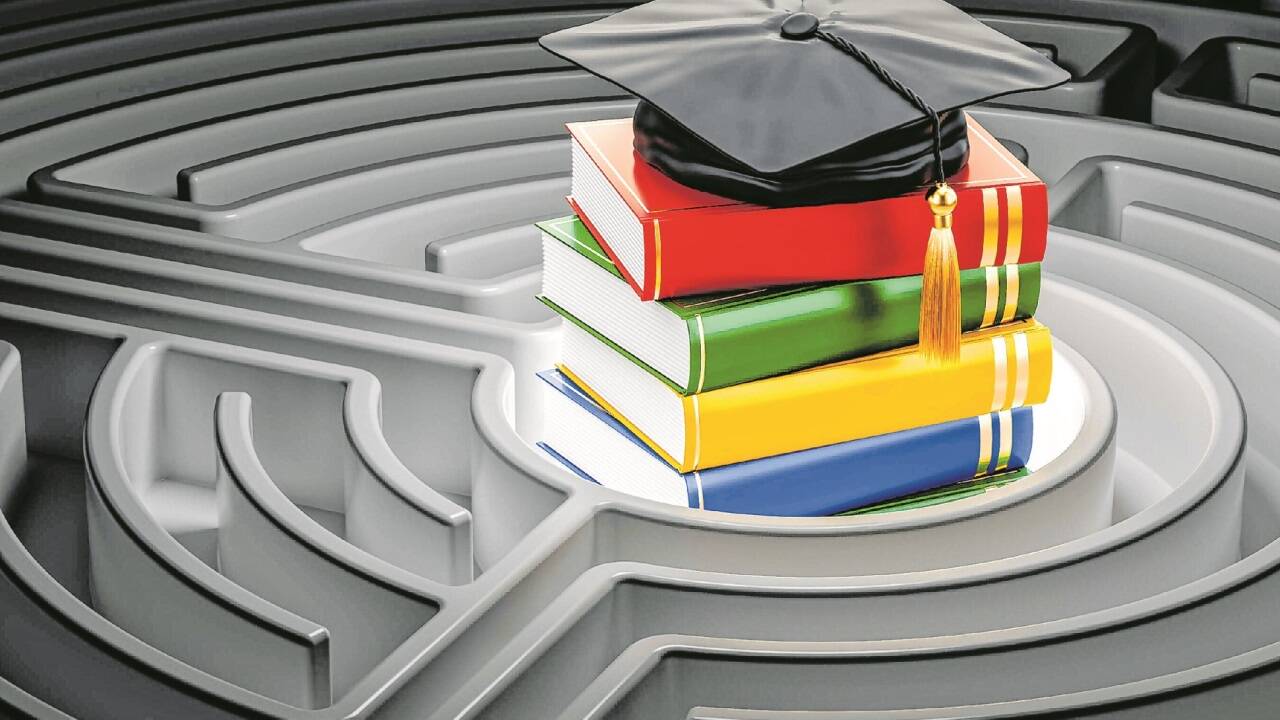Die aktuelle Auswertung der Studierendensozialerhebung des IHS zeigt ein vielschichtiges Bild, wenn es um Studienzugänge und -verläufe in Österreich geht. Das zeigen unter anderem die folgenden vier ausgewerteten Aspekte:
1. Studienzugang
Mehr als die Hälfte der Studierenden in Österreich stammt aus nicht akademischen Familien. Der Anteil der sogenannten "First Generation"-Studierenden liegt an Universitäten bei 52 Prozent und an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie diese nun auch heißen dürfen, bei 65 Prozent.
2. Erwerbstätigkeit während des Studiums
Die Erwerbstätigkeit der Studierenden ist gestiegen. Im Sommersemester 2023 arbeiteten bereits 69 Prozent der Studierenden. Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt bei 21 Stunden pro Woche, was laut Erhebung den Studienaufwand negativ beeinflusst, besonders wenn mehr als neun Stunden pro Woche gearbeitet wird.
3. Gründe für Erwerbstätigkeit
Die Mehrheit der Studierenden arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, 55 Prozent haben hierbei bewusst einen Job, der inhaltlich mit ihrem Studium verbunden ist. Kritiker, wie die Österreichische Hochschüler_innenschaft und die Arbeiterkammer, fordern Maßnahmen wie eine Erhöhung der Studienbeihilfen und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Studium und Arbeit.
4. Geschlecht und Herkunft
Frauen stellen mit 56 Prozent die Mehrheit der Studierenden, besonders in den Bereichen Bildungswissenschaften, Gesundheit und Pharmazie. Der Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund liegt bei zehn Prozent. Zudem gibt es eine Zunahme an Studierenden, die nach der traditionellen Matura ins Studium gehen, während 23 Prozent einen verzögerten Studienbeginn haben.
Überraschende Details hinter den Ergebnissen
Für den IHS-Bildungsforscher Martin Unger sind diese Ergebnisse weniger überraschend als so manches Detail dahinter. "Für uns ist beispielsweise nicht überraschend, dass HTL-Absolventinnen und -Absolventen in technischen Fächern höhere Erfolgsquoten haben, auch wenn oft behauptet wird, das sei auch bei AHS-Absolvent:innen so. Interessanter sind schon Aspekte wie steigende Abbruchquoten auch bei berufsbegleitenden FH-Studien in technischen Fächern - wahrscheinlich durch sogenannte Job-outs. Oder die Übertritte, was die Sektoren betrifft: In absoluten Zahlen gehen etwas mehr Studierende nach dem FH-Bachelor an die Uni als umgekehrt - das liegt eventuell an deren immer noch starker Orientierung in Wirtschaft und Technik."
Generell würde die Betrachtung von Verläufen aber immer etwas darunter leiden, dass ein langer Zeitraum betrachtet werden müsse und in der Zwischenzeit bildungs- und weltpolitische Dinge zu Veränderungen führen könnten. So ist die aktuelle Betrachtung eine der Anfängerkohorten von 2016/17.
Bildungsvererbung in Österreich muss differenziert betrachtet werden
Ein viel diskutierter Aspekt ist auch jener der Bildungsvererbung in Österreich, die zum Beispiel im OECD-Vergleich hoch ist. Das müsse man differenziert betrachten, sagt Martin Unger: "Ein wichtiger Faktor ist die Lehre in Österreich. Die Elterngeneration hat im geringeren Ausmaß studiert, weil sie vielfach noch das stärkere System war, und auch eine gute Karrierevoraussetzung. Andere Bildungssysteme haben seit jeher mehr Kohorten in der Schule, weil es keine Berufsausbildung in dieser Form gibt. Dort gehen dann auch mehr Leute auf die Uni und erhalten diese teils dort." Weiters seien zum Beispiel die letzten beiden Jahre der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) in der internationalen Klassifikation akademische Ausbildungen, was in Österreich wiederum zu einem hohen Anteil an MINT-Studierenden in der Statistik führt. Allein diese beiden Faktoren machten die Systeme schwer vergleichbar, sagt der Bildungsforscher.