Hilfe! Warum werden wir immer dicker?
Theoretisch wissen wir, welche Lebensmittel gesund sind und uns schlank bleiben lassen. Praktisch essen wir Dinge, die uns nicht guttun. Rettet uns da die "Lebensmittelampel"?

Paleo, Low Carb, Intervallfasten? Oder doch lieber Keto, Dash oder Glyx? Das alles sind Diäten, die eine Bikinifigur versprechen. Und genau das wünschen Sie sich jetzt bestimmt, liebe Leserin, lieber Leser, eine Geschichte zum Thema Abnehmen, nach Wochen des Genusses? Es ist jedes Jahr dasselbe: Theoretisch wissen wir, welche Lebensmittel gut für uns wären, dass Sport beim Abnehmen hilft, praktisch sind uns oft Produkte aus der Lebensmittelindustrie wie Chips oder Cola und die Fernbedienung näher.
Frage nach gesunder Ernährung ist so alt wie die Menschheit
Die Frage nach gesunder Ernährung ist so alt wie die Menschheit. In der griechisch-römischen Antike stand der Ausgleich der Extreme im Zentrum, eine Mäßigung, was der heutigen "Mittelmeer-Diät" gleichkäme, sagt der Historiker Michael Brauer. Dann gab es die Esskultur in kriegerischen Gesellschaften, bei denen jener höchstes Prestige genoss, der am meisten essen und trinken konnte. Aufhören oder Entsagung galt als Zeichen von Schwäche. Geblieben davon sind "Esskulturen" wie All you can eat, Schnitzel, die über den Tellerrand hängen, oder Esswettbewerbe.
Schon im Mittelalter litten die, die es besser wissen sollten - etwa die Mönche -, unter Fettleibigkeit, während die Bevölkerung vielerorts hungerte. Wohlhabende Bauerfamilien servierten ihren hart arbeitenden Knechten nachweislich schon im 19. Jahrhundert mehrere warme Mahlzeiten pro Tag. Die Mönche aßen mindestens genauso viel, hatten aber zu wenig Bewegung. Das könnte man auch als Dilemma der Gegenwart bezeichnen: Die Kalorienzufuhr bei Büroangestellten und körperlich schwer arbeitenden Personen ist vielfach gleich hoch.
Als die Menschen in die Städte zogen und keine Gärten, somit kein eigenes Obst und Gemüse mehr besaßen, begann der Aufbruch ins Zeitalter der industriellen Nahrungszubereitung. "Wien hatte 1910 zwei Millionen Einwohner, es gab keine Selbstversorgung mehr, da waren Produkte wie der Suppenwürfel ein Segen", betont der Historiker Brauer. Viele Arbeiter in dieser Zeit verfügten nicht einmal über eigenen Wohnraum, sie teilten sich im Schichtbetrieb die Betten, Küchen für die frische Zubereitung fehlten zur Gänze. Die Lebensmittelindustrie war, so gesehen, für viele Menschen eine Bereicherung.
In den Regalen der Supermärkte ist nur ein Bruchteil gesund
In den vergangenen Jahrzehnten trug die Branche hingegen dazu bei, dass sich unsere Ernährung nicht unbedingt zum Besseren entwickelt hat. Wer durch einen Supermarkt geht, wird feststellen: Wirklich gesund ist ein bescheidener Bruchteil dessen, was sich in den Regalen stapelt. Die Europäische Kommission will deshalb 2023 eine verbindliche europäische Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel vorschlagen. Diese zeigt dann, so der Plan, auf den Verpackungen eine Art "Lebensmittelampel" - in Grün- und Gelbtönen bis Rot soll bald gut sichtbar an, wie es um die Nährstoffe des Produkts bestellt ist (weiter nach der Grafik).
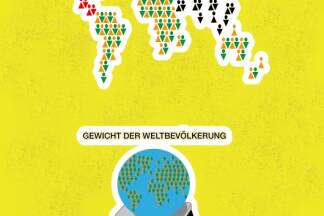
Bei diesem sogenannten Nutri-Score werden positive und negative Produkteigenschaften aufgerechnet. Gut, das sind Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, bestimmte Öle oder Eiweiß. Negativ bewertet sind Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren. Im Vorfeld schon gingen die Wogen hoch, hat der Nutri-Score doch einige Schwächen - wie jeder Konsument feststellen kann, wenn er einige Produkte zur Hand nimmt, die bereits farblich gekennzeichnet sind. So können Pommes-frites-Produkte die Farbe Dunkelgrün (A) erhalten, weil Hauptbestandteil ja die gesunde Kartoffel ist, die vielleicht noch mit einem besseren Pflanzenöl zubereitet wurde als beispielsweise ein Produkt, das nur mit B (Hellgrün) bewertet wurde. Dass die Kartoffeln frittiert sind, spielt hierbei keine Rolle. Die Teilnahme ist für Lebensmittelhersteller freiwillig - verpflichten sie sich dazu, wird dann aber deren gesamte Produktpalette bewertet, also von der Schokolade bis zur Tiefkühlpizza.
Brauchen wir überhaupt eine Lebensmittelampel?
In manchen Ländern ist die Lebensmittelampel bereits in Verwendung, etwa in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Belgien. In Österreich wartet man auf die Entscheidung der EU-Kommission.
Doch sollte die zentrale Frage nicht lauten: Brauchen wir überhaupt eine Lebensmittelampel? Immerhin ist hinlänglich bekannt, dass Obst und Gemüse gesünder sind als Kartoffelchips und Cola. Ja, brauchen wir, sagt der Wiener Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Denn obwohl fast jeder wissen müsste, was eine halbwegs vernünftige Ernährung sei: Jedes dritte Kind in Österreich sei übergewichtig.
Eine Untersuchung an Bundesheerrekruten zeigte, dass der durchschnittliche Body-Mass-Index zwischen 2003 und 2018 von 22 auf 22,8 anstieg. Der Anteil der Übergewichtigen stieg von 15,3 auf 20,4 Prozent an, die krankhaften Ausprägungen Adipositas I bis III verdoppelten sich nahezu.
Fehlernährungen, oft in Kombination mit Bewegungsmangel, zeigten sich an verschiedensten Erkrankungen: Stoffwechsel-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Beschwerden beim Bewegungs- und Stützapparat bis hin zu psychischen Problemen, verstärkt durch Stigmatisierung von Kindern. "Das sind Probleme, die uns aufgrund unserer Ernährung bevorstehen. Sie kosten viel Leid und Geld für die Gesundheitssysteme", betont Hutter. Würden wir uns mehr mit der Qualität und dem Wert unserer Lebensmittel auseinandersetzen, ist er überzeugt, würden wir nicht 40 Prozent davon wegwerfen.
Unwissen über gesunde Ernährung bei bildungsarmen Schichten am größten
Das Unwissen über gesunde Ernährung korreliere zudem stets mit wenig Bildung. Betroffen von Übergewicht seien insbesondere gewisse migrantische Gruppen - die man mit einem Ampelsystem gut erreichen könne.

Auch bei Foodwatch Österreich ist man überzeugt, dass es den Nutri-Score braucht. Seit zwei Jahren gibt es die spendenbasierte Organisation auch in Österreich, sie wirft einen kritischen Blick auf die Lebensmittelindustrie und nimmt sich der Beschwerden enttäuschter Konsumenten an (www.dasregtmichauf.at). Dort hofft man, dass die Firmen auf den Nutri-Score mit veränderten Rezepturen reagieren, um bessere Bewertungen zu erreichen: weniger Zucker, mehr Gemüse statt Käse auf der Pizza und weniger gesättigte Fettsäuren. Zusätzlich brauche es auch Bildungsangebote über ausgewogene Ernährung, schon in den Schulen, sagt Heidi Porstner von Foodwatch. Gemeinsam zu kochen sei wichtig, gleichzeitig gehörten die ungesunden Angebote in den Schulen - Stichwort Buffets, Süßigkeiten- wie Getränkeautomaten - reduziert. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch ein Verbot von Junk-Food-Werbung, die sich an Kinder richtet. "Das Drama dabei ist", sagt Porstners Kollegin Lisa Kernegger, "dass sich die Geschmacksvorliebe im Kindesalter entwickelt. Die Unternehmen wissen das - und setzen in der Werbung mit kindgerechtem Inhalt gezielt auf ihre Konsumenten von morgen." Was man sich bei Foodwatch Österreich wünscht: dass es wie in Deutschland einen breiteren Zusammenschluss von Ärztinnen und Ärzten gibt, die sich für eine bessere Ernährung und entsprechende Maßnahmen auch öffentlich aussprechen.
Gesundes müsse günstiger werden
Umweltmediziner Hutter ist überzeugt, dass es mehr politischen Willen braucht, um das Thema Fehlernährung in den Griff zu bekommen. Was gesund sei, müsse günstiger werden, vor allem Bioprodukte. Und es brauche Mut, Dinge auf politischer Ebene anzusprechen. Ein fleischloser Tag würde viel bringen, betont Hutter, wäre da nicht der teils fast aggressive Abwehrreflex von Herrn und Frau Österreicher, die sich ihr tägliches Schnitzel nicht verbieten lassen möchten. "In der Diskussion um die Energiekosten hat sich gezeigt: Ein Politiker darf keine Empfehlung für eine ideale Raumtemperatur aussprechen. Genauso ist es bei Fragen im Straßenverkehr und bei der Ernährung."
Dennoch: Schon an Schulen müsse gelehrt werden, wie man sich gesund ernähre, genauso brauche es Transparenz, woher das Fleisch und die Lebensmittel auf dem Teller seien. Ungesunde Lebensmittel müssten endlich beim Namen genannt werden, fordert der Umweltmediziner. "Zucker klingt so freundlich, das ist er aber nicht, Zucker ist ein Schadstoff", sagt er.
Für die Psychologin Cornelia Fiechtl leiten vor allem Emotionen unser Essverhalten, wie sie in ihrem Buch "Food Feelings" schreibt: Wissenschaftlich sei erwiesen, dass gerade Menschen, die viel grübeln, ständig nachdenken, von Scham, Ärger, Traurigkeit oder Minderwertigkeitsgefühlen begleitet sind, gern als "Trost" essen. Für Fiechtl spielt auch die Diät- und Abnehmindustrie eine nicht unerhebliche Rolle: Sie vermittle uns permanent, Abnehmen sei der Schlüssel zum Glücklichsein und Wohlfühlen.