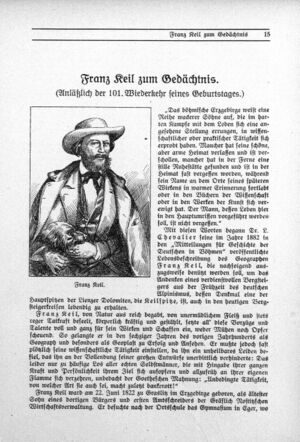Franz Keil (Geoplastiker)
Franz Keil (* 22. Juni 1822 in Graslitz [tschechisch: Kraslice], Böhmen; † 10. März 1876 in Marburg an der Drau [slowenisch: Maribor], Untersteiermark) war ein österreichischer Geoplastiker, Kartograph und Alpinist. Er gilt als bedeutender Erbauer der im 19. Jahrhundert beliebten Gebirgsreliefs.
Leben
Keil konnte sich wegen der schlechten finanziellen Situation seiner Familie zunächst kein Studium leisten. Er absolvierte in Königsberg und später in Falkenau eine Apothekerlehre. Ab 1845 besuchte er schließlich die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag, wo er Pharmazie studierte. 1846 wurde er Assistent für Botanik, brach sein Studium aber 1848 ab und musste seine Assistentenstelle aufgeben. Er ging nach Wien und arbeitete später in Graz und Gastein als Provisor. Von Oktober 1852 bis September 1858 war er Apotheker in Lienz in Osttirol. Dort begann er mit dem Bergsteigen. Im Jahr 1853 bestieg er den Großvenediger, 1855 den Großglockner.
Er begann sich neben Geognosie, Kartografie und Meteorologie mit der Herstellung von Reliefs zu befassen. Nach seiner ersten erfolgreichen Arbeit, einer Darstellung der Lienzer Dolomiten konnte er, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gefördert, diese Tätigkeit ab 1859 hauptberuflich ausführen. Seine Reliefs, die besonders als Lehrmittel geschätzt wurden, erstellte er ohne Vorlagen, nur aus dem Gedächtnis und auf Grundlage eigener Höhenmessungen. Dennoch galt sein Relief der Glocknergruppe, eines seiner meistbeachteten Werke, lange Zeit als die genaueste Darstellung des Gebietes. Ein vierzehnteiliges Alpenpanorama im Maßstab 1:48 000, das die Hohen Tauern, die Berchtesgadener Alpen und weitere Teile des Landes Salzburg umfasst, wurde auf der Weltausstellung 1862 in London ausgezeichnet, obwohl nur zehn Teile wirklich vollendet waren. Ursprünglich sollte das Panorama 35 Teile umfassen. Bekannt wurden auch seine Reliefs des Schneebergs und des Untersbergstocks.
1860 übersiedelte Keil in die Stadt Salzburg, um der Berchtesgadener Gebirgsgruppe, die er zu bearbeiten begonnen hatte, näher zu sein. In Salzburg gründete er ein "Geoplastisches Institut", in dem er auch Mitarbeiter beschäftigte. Im Sommer 1862 hielt er sich teils im Lungau und Pinzgau, teils um Kitzbühel und Unken, teils im Pongau auf. 1864 arbeitete er in den Hohen Tauern (besonders im Oberpinzgau) und in den Lienzer Dolomiten. Keil blieb bis 1865 in Salzburg.
Franz Keil starb 1876 in Marburg, wo er seit 1870 gelebt hatte, nachdem er bei einem Absturz schwer verletzt und durch ein daraus folgendes Rückenmarkleiden gelähmt war
Geoplastiker
Franz Keil gilt als bedeutender Erbauer der im 19. Jahrhundert beliebten Gebirgsreliefs. Seine Arbeiten erstellte er ohne Vorlagen, nur aus dem Gedächtnis und auf Grundlage eigener Höhenmessungen. Sein Hauptwerk war ein vierzehnteiliges Alpenpanorama im Maßstab 1:48.000, das die Hohen Tauern, die Berchtesgadener Alpen und weitere Teile des Landes Salzburg umfasst.
Seine Reliefs, die besonders als Lehrmittel geschätzt wurden, erstellte er ohne Vorlagen, nur aus dem Gedächtnis und auf Grundlage eigener Höhenmessungen. Dennoch galt sein Relief der Glocknergruppe, eines seiner meistbeachteten Werke, lange Zeit als die genaueste Darstellung des Gebietes. Ein vierzehnteiliges Alpenpanorama im Maßstab 1:48 000, das die Hohen Tauern, die Berchtesgadener Alpen und weitere Teile des Landes Salzburg umfasst, wurde auf der Weltausstellung 1862 in London ausgezeichnet, obwohl nur zehn Teile wirklich vollendet waren. Ursprünglich sollte das Panorama 35 Teile umfassen. Bekannt wurden auch seine Reliefs des Schneebergs und des Untersbergstocks.
Das Alpen- bzw. Salzburger Landesrelief
- Hauptartikel Salzburger Landesrelief
Durch Keils Erkrankung blieb sein großes Alpenpanorama unvollendet. Es wurde im Jahr 1865 mit Unterstützung der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde vom städtischen Museum Carolino-Augusteum erworben. Den zehn vollendeten Sektionen Keils fügten Ministerialrat i. P. Rudolf Edler von Kendler und Major i. P. Josef Skuppa zwei weitere an. 1892 übernahm der pensionierte Militärkartograph Gustav Edler von Pelikan die Betreuung des Werkes. Er vermehrte das Relief bis 1895 um weitere 13 Sektionen und schenkte diese Arbeit dem Museum. Das Werk, nun "Salzburger Landesrelief" genannt, fand nach der Gründung des Hauses der Natur dort seinen bleibenden Standort.
Kartograph
Keil zeichnete zahlreiche topographische Karten, die im Druck Verbreitung fanden. Die meisten sind als Nebenprodukte seiner geoplastischen Arbeiten anzusehen. Er gilt als einer der bedeutendsten Vorläufer der planmäßigen Alpenvereinskartographie. So stellte er als erster die Ankogelgruppe, die Glocknergruppe und die Venedigergruppe dar. Als Pionier der alpinen Kartographie hatte er auch Anteil an der endgültigen Benennung etlicher Alpengipfel, wobei er sich möglichst auf in der örtlichen Bevölkerung gebräuchliche Bezeichnungen stützte. Der Große Geiger erhielt seinen heutigen Namen 1855 von Franz Keil.
Bei einer Versammlung des Alpenvereins im Februar oder März 1865 "[...] hielt Herr Franz Keil einen Vortrag über die Venediger Gruppe, in welchem er zunächst eine kurze Charakteristik der Gruppe überhaupt gab, dann Einzelheiten der Besteigung das Groß-Venediger besprach und mit einem Hinweis auf dasjenige, was in dieser Gruppe noch zu leisten sei, schloß. Der Vorschlag, zwei bis jetzt namenlose Spitzen 'Simonyspitzen' zu taufen, fand die laute Zustimmung der Versammlung.[...]"[1]
Alpinist
Es war das Erlebnis der Bergwelt, das Keil zum Alpinismus und zu seinem Beruf gebracht hatte. Als Alpinist konnte Franz Keil unter anderem die erste bekannte Besteigung des Hochschobers verzeichnen, auf den heute der Franz-Keil-Weg führt. Auch die Keilspitze (2 739 m ü. A.) in den Lienzer Dolomiten und die Keilscharte in den Hohen Tauern sind nach ihm benannt. Er gilt auch als Erstbesteiger des Rainerhorns (3 559 m ü. A.) und des Spitzkofels (2 717 m) bei Lienz. Der Bau der Johannishütte in der Venedigergruppe geht auf seine Initiative zurück.
Veröffentlichungen
- "Über topographische Reliefkarten im Allgemeinen und über einige charakteristische Gebirgsformen, insbesondere der Salzburger Alpen", in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 2, 1861/62, S. 17-32
- "Topographische Reise- und Gebirgskarte der Umgebung von Salzburg", 1867,[2] erschienen im Glonner'scher Verlag und Buchhandlung
Namensgebungen
- Auf den Hochschober führt der "Franz-Keil-Weg".
- In den Hohen Tauern ist die "Keilscharte" beim Großen Bärenkopf nach Franz Keil benannt.
- In den Niederen Tauern gab es eine heute nicht mehr bestehende Franz-Keil-Hütte[3][4] am Fuß des Hochgollings.
Weblink
Quellen
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Franz Keil (Geoplastiker)"
- Nekrolog auf Franz Keil in MGSLK XVI (1876), 493
- Artikel "Keil, Franz (1822–1876), Geoplastiker" in Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 3 (Lfg. 13, 1963), S. 282.
- Carl Aberle: "Über Franz Keil’s geognostisch-colorirte topographische Reliefkarte des größten Theiles der salzburgischen Alpen", in: MGSLK 7, 1867, S. 299-352
- Guido Müller, Franz Keil. Ein Alpenforscher und Pionier der plastischen Gebirgsdarstellung (1822–1876), in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 116, 1976, S. 287-310 und www.zobodat.at/biografien, pdf
- derselbe, Gustav Pelikan (1840 – 1919). Ein bedeutender österreichischer Kartograf und Geoplastiker. In: Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 38 (Salzburg 2005), S. 27–36.
Einzelnachweis
- ↑ ANNO, "Fremden-Blatt", Ausgabe vom 18. März 1865, Seite 4
- ↑ books.google.at/
- ↑ siehe Ennstalwiki → Franz-Keil-Hütte
- ↑ Verlinkung(en) mit "enns:" beginnend führ(t)en zu Artikeln, meist mit mehreren Bildern, im EnnstalWiki, einem Schwesterwiki des SALZBURGWIKIs