Märtyrer. Im Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang wimmelt es von Heiligen, die Höllisches erleiden. Welche Botschaft vermitteln sie?

In der Mitte: heiliger Sebastian, um 1450, Zirbenholz, Sammlung Vogl-Reitter im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang. BILD: SN/BERGBAU- UND GOTIKMUSEUM LEOGANG/ SUSANNE BAYER
Sebastian hängt nackt am Pfahl, sein Körper ist mit Pfeilen durchbohrt, Blut trieft aus den Wunden, und doch verrät sein Blick innere Ruhe, vielleicht ein wenig Melancholie. Barbara hält mit drei Fingern geradezu zärtlich die Spitze jenes Turms, der ihre Qual symbolisiert: Als junge Frau war sie darin verhöhnt, einsam und eingesperrt, weil ihr Vater ihr den freien Willen verweigern wollte. Aber das ihr zugefügte Leid hat sie nicht gebrochen. Sie ist Königin geworden. Nicht allein Güte ist aus ihrem Blick zu lesen, sondern eine Traurigkeit - vielleicht darüber, dass ein rechter Weg manchmal nur schmerzvoll und im bitteren Alleingang zu finden ist.

Laurenzius und Vitus sind standhaft
Veit steckt in einem Kessel brutzelnden Öls, blickt gefasst nach vorn und faltet die Hände absichtsvoll zum Gebet. Auch Laurenzius habe Grässliches zu erleiden gehabt, er sei auf heißem Rost geröstet worden, ergänzt Hermann Mayrhofer, Gründer und Kustos des Bergbau- und Gotikmuseums in Leogang. „Ein fürchterlicher Tod!"
Dass sich die Figuren solcher Märtyrer im Leoganger Museum tummeln, hat mit dem Bergbau zu tun: Der standhafte Laurenzius sei „ein Spezialpatron der Hüttenarbeiter", weil auch diese am Hochofen fast geröstet worden seien, schildert Hermann Mayrhofer. Sebastian, zudem allgemeiner Patron der Gesundheit, sei ein Vorbild dafür, in einer Qual nicht klein beizugeben. „Die Bergleute sind gefährdet gewesen" - durch Krankheit, schwere Arbeit, schlechtes Klima im Berg. „Das war alles nicht lustig." Daher sei die Lebenserwartung der Bergleute geringer gewesen als anderer Leute.
Die heilige Barbara passt ebenso in dieses Bild: Sie hat die Dunkelheit im Turm ertragen. „Auch die Bergleute haben gehofft, dass sie gut aus der Grube herauskommen", schildert Hermann Mayrhofer.
Die Märtyrer lehren wie Jesus: Einer extremen Pein- also einer Hölle - kann man Herr werden, indem man sich Wichtigerem und Anderem zuwendet als dem Hier und Jetzt. Was dieses Wichtigere ist, lässt sich an Skulpturen wie jenen in Leogang nicht ablesen. Aber wie es zu erreichen ist, wird in Haltungen, Gesten und Gesichtszügen angedeutet: Gelassenheit, Gefasstheit, Vertrauen, Frömmigkeit, Güte sowie standhaftes Hinnehmen der qualvollen Situation gepaart mit einem Darüber-hinweg-Blicken.
„Das Mittelalter war eine gläubige Zeit", stellt Hermann Mayrhofer fest. Die Schnitzer und Maler seien „gute Dolmetscher" des Inhalts der Bibel gewesen. Der Kustos erinnert an Gemälde von Johannes und Maria unter dem Gekreuzigten: „Der Lieblingsjünger und die Mutter haben alles mitgetragen! Das sind Tröster und Fürsprecher." Warum Tröster? Zum einen tröste das Wissen, von einer Not nicht allein betroffen zu sein. Und zum anderen spende es Zuversicht, wenn es einem selbst in der Qual noch immer besser ergehe als einem anderen, erläutert Andreas Herzog, stellvertretender Kustos im Leoganger Museum. Hermann Mayrhofer ergänzt: „Man braucht im praktischen Leben nicht so weit schauen: Wenn man selber ein Leid hat und ein bisschen hellhörig ist, kommt man gleich drauf, dass es viel tragischere Schicksale gibt."
Fürsprecher haben Verständnis
Und Fürsprecher würden diese Märtyrer und Heiligen, weil ihr Anblick versichere: „Der versteht mich, der hilft mir auch", sagt Andreas Herzog.
Das Leoganger Museum ist heuer - im Sommer seines 30-Jahr-Jubiläums - noch reicher als bisher bestückt mit gotischer Kunst, insbesondere solcher über Jahrhunderte bei den Bergleuten bewährten Tröster- und Fürsprecherfiguren. Denn es kann neueste Schenkungen und Dauerleihgaben herzeigen.
Die eingangs erwähnte Figur des Sebastian ist ein Exponat aus der Sammlung Vogl-Reitter, die eine Kitzbüheler Apothekersgattin vor rund 150 Jahren in der Umgebung von Kitzbühel und im Pinzgau zusammengetragen hatte. Die Enkelin dieser Maria Vogl, Editha Reitter, hat diese Sammlung dem Leoganger Museum geschenkt, das sie nun in der Sonderausstellung ,,Perlen der Gotik" erstmals als Einheit präsentiert.
Eine zweite Sonderausstellung ist den Schraubmedaillen gewidmet: kleine, flache Dosen mit Bildchen im Inneren, die die in den 1730er-Jahren zur Emigration gezwungenen Salzburger als Trostspender mit sich trugen. HEDWIG KAINBERGER
Beispiele für Regionalmuseen

Bramberg
Mit „Smaragde und Kristalle" lockt das Museum in Bramberg im Pinzgau als Spezialmuseum für funkelnde Kostbarkeiten aus den Hohen Tauern. Auch die Pflanzen- und Tierwelt im Pinzgau wird vorgestellt, vor allem die Welt der Bienen. Im alten Wilhelmgut und dessen Zubauten - wie Backofen, Troadkasten, Mühle und Stadel - ist einstiges Leben am Land zu erkunden. Die heurige Sonderausstellung „Der Gletscher weint" schildert die Folgen des Klimawandels an Oberpinzgauer Gletschern.


Bürmoos
Das Torf-, Glas- und Ziegelmuseum ergänzt seine Schau über Orts- und Industriegeschichte von Bürmoos, wie über einstige Torfstecherei und Glasfabrik, heuer um eine Gedenkausstellung zum 50. Todestag des Autors Georg Rendl. Da der neben „Glasbläser von Bürmoos" auch einen „Bienenroman" geschrieben hat, wird auch die Arbeit von Bienen und Imkern geschildert.
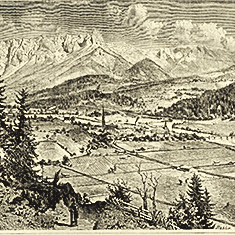
Bischofshofen
Die Sonderausstellung ist „Bischofshofen in alten Ansichten" gewidmet - mit alten Fotografien, Plänen sowie Exponaten aus der Sammlung, sodass „alte Ansichten" von der Bronzezeit bis ins Heute reichen.

Böckstein
Das Montanmuseum in Böckstein entführt in die Zeit von Reichtum und schwerer Arbeit: den Gasteiner Bergbau seit 1342. Im Salzstadl und im Samerstall wird die einstige Goldaufbereitung dargestellt.

Bad Dürrnberg
Das Keltendorf auf dem Dürrnberg ist eine Filiale des Halleiner Keltenmuseums am Eingang zu den Salzwelten. Hier gibt es Einblicke in den Alltag der Bergleute, die vor mehr als 2500 Jahren nach dem „weißen Gold", dem Salz, gegraben haben. Die Nachbauten von Wohnhäusern und Werkstätten einer latènezeitlichen Siedlung wurden 2013 erneuert. Schaukästen und Filme informieren über die archäologischen Ausgrabungen zur Siedlungsgeschichte auf dem Dürrnberg.











